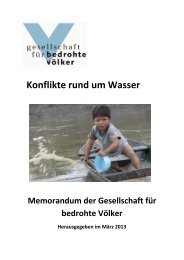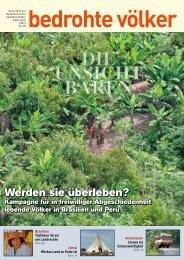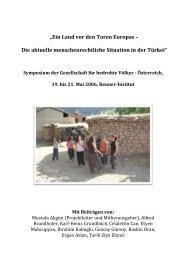Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Moderne Autonomiesysteme - Gesellschaft für bedrohte Völker
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
58<br />
<strong>Moderne</strong> <strong>Autonomiesysteme</strong><br />
Auf der anderen Seite kritisieren Verteidiger von<br />
Einheitsstaaten, dass Autonomie die staatliche<br />
Einheit aushöhlt und eine kollektive ethnische<br />
Identität konsolidiert, die früher oder später in<br />
Sezessionsforderungen mündet. 100 Sorgsam gepflegte<br />
ideologische Vorstellungen von „heiliger Souveränität“<br />
und der Einheit des Vaterlands stehen im Vordergrund,<br />
doch harte Interessen an der Kontrolle und Nutzung<br />
eines Territoriums, seiner Ressourcen und seiner<br />
militärischen Bedeutung stehen dahinter. In solchen<br />
Fällen treffen divergierende Auffassungen von Staat<br />
aufeinander und anscheinend unüberwindliche<br />
Gräben scheinen <strong>Völker</strong> zu trennen, die im selben<br />
Staat zusammenleben. Wenn z.B. eine durch starke<br />
politische Gruppen artikulierte Mehrheit den Staat als<br />
eine Struktur begreift, die vor allem die Vorherrschaft<br />
dieser Gruppe konsolidieren und ausbauen soll, ist die<br />
Teilung der Macht mit Minderheitengruppen und die<br />
Neuverteilung der Ressourcen im Zuge von Autonomie<br />
oder asymmetrischem Föderalismus inakzeptabel.<br />
Dies geschieht heute in Sri Lanka, in der Türkei und in<br />
Burma. In diesen Fällen sind Kompromisse hinsichtlich<br />
Autonomie besonders schwierig, zumal ein Bruch mit<br />
einer traditionsreichen, breit verwurzelten Staatsideologie<br />
und bestimmten Verfassungs-prinzipien<br />
seitens der Machteliten des Staates vonnöten wären.<br />
Die Angst vor Autonomie als ein erster Schritt zur<br />
Sezession ist dann besonders ausgeprägt, wenn<br />
ein Minderheitsvolk in seinem angestammten<br />
Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zu seiner<br />
Schutzmacht lebt wie z.B. Kaschmir und Pakistan,<br />
Tamil Eelam und Tamil Nadu, Türkisch-Kurdistan und<br />
Irakisch-Kurdistan. Bilaterale staatliche Abkommen<br />
könnten diesen Konflikt entspannen, wobei einseitige<br />
Grenzveränderungen ausgeschlossen werden können.<br />
In allen realen Konstellationen müssen die Folgen der<br />
Verweigerung von Autonomie mit den Vorteilen von<br />
Autonomie <strong>für</strong> die Stabilität und Zusammenarbeit mit<br />
dem Nachbarstaat abgewogen werden.<br />
„Führungskräfte in Regierungen“, meint Yash<br />
Ghai, „be<strong>für</strong>chten, dass Autonomie die Ausübung<br />
der Schlüsselfunktionen eines Staates behindert.<br />
Autonomie könne die wirtschaftliche und administrative<br />
Effizienz in Frage stellen aufgrund der Komplexität<br />
und Verdoppelung von Verwaltungsinstitutionen.<br />
Autonomie führt unvermeidlicherweise zu einer<br />
Philippinen, und die Bewegung der Kanaken auf Neukaledonien.<br />
100 Dies ist die Auffassung von Svante E. Cornell (2002) in: Autonomy<br />
as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical<br />
Perspective, World Politics, volume 54, n. 2, Januar 2002, S. 245-<br />
276<br />
Steigerung der Verwaltungskosten (auch wenn es in<br />
der Realität Effizienzgewinne gibt, wie sie die Theorie<br />
der Dezentralisierung annimmt). Autonomie kann auch<br />
die Wirtschaftssphäre berühren, insbesondere wenn<br />
regionale Steuern, Präferenzen <strong>für</strong> lokales Kapital und<br />
Beschränkungen der Mobilität der Arbeit eingeführt<br />
werden. Autonomie kann die Umverteilungsaufgaben<br />
des Staates beeinträchtigen und so die Legitimation<br />
der Autonomie selbst in Frage stellen“. 101<br />
Ein funktionaler Vergleich der heute rund 60<br />
bestehenden <strong>Autonomiesysteme</strong> könnte diese Theorie<br />
empirisch prüfen aber auch ihr Gegenteil belegen.<br />
Doch sollte in einer solchen Art von Betrachtung der<br />
Hauptzweck von Autonomie nicht vergessen werden:<br />
nicht ökonomische oder administrative Effizienz eines<br />
Staats ist das Hauptkriterium, sondern die Achtung<br />
der individuellen und kollektiven Menschen-rechte<br />
und Minderheitenrechte.<br />
Ein weiteres gängiges Argument, das von Zentralstaaten<br />
gegen Autonomie ins Feld geführt wird, besteht in der<br />
„Domino-Theorie“: wenn Autonomie einmal <strong>für</strong> eine<br />
Region und eine Minderheit eingeführt wird, würde<br />
demnach eine endlose Reihe von Autonomieforderungen<br />
aus allen Ecken des Staates losgetreten. Dieses<br />
Argument wird vor allem in multinationalen Staaten<br />
wie Indien, Nigeria, Indonesien und Burma/Myanmar<br />
den Selbstbestimmungsbewegungen entgegnet, aber<br />
auch von der russischen Regierung zur Rechtfertigung<br />
ihrer Tschetschenien-Politik. Es muss im Licht der<br />
historischen Fakten erst gründlich geprüft werden,<br />
doch in der übergroßen Mehrheit der 20 Staaten mit<br />
funktionierenden Territorialautonomien lässt sich<br />
keine „Welle der Nachahmung“ feststellen. Wiederum<br />
sei betont: in jedem Minderheitenkonflikt ist die<br />
rechtliche, politische und moralische Legitimation<br />
einer Autonomieforderungen abzuwägen mit der<br />
Legitimation des Zentralstaats, ein Maximum an<br />
Macht auf zentraler Ebene zu halten, wobei seine<br />
Souveränität und Grenzen gar nicht in Frage gestellt<br />
werden.<br />
Ein häufiger Einwand bezieht sich auf die Schaffung<br />
von neuen ethnisch definierten Minderheiten innerhalb<br />
autonomer Regionen, die sozialer oder rechtlicher<br />
Diskriminierung ausgeliefert sein könnten. Diese Art<br />
von Kritik stammt aus einer Sicht der Menschenrechte,<br />
die bei der Anerkennung von Gruppenrechten die<br />
Gefahr der Diskriminierung von Individuen derselben<br />
Region in den Vordergrund stellen, die nicht zu diesen<br />
Gruppen gehören. Doch auch Wissenschaftler, die<br />
101 Yash Ghai (2000), 499