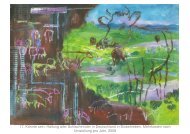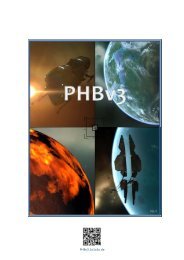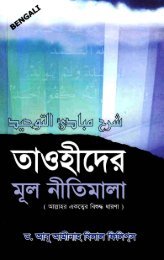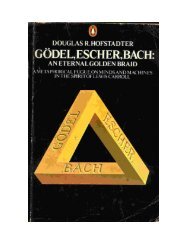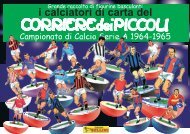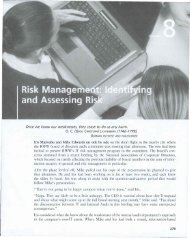1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Studie zum Erweis der grundlegenden Beziehung, welche die wahre Erkenntnis zum<br />
entsprechenden Transzendentale unterhält, zunächst insofern der Gegenstand das erkennende<br />
Subjekt sinnlich berührt und daher in diesem sein -auf die ursprungshafte Schönheit verweisen<strong>des</strong>-<br />
Bild reproduziert; und zweitens insofern der Verstand die unter dem Sinnlichen verborgene<br />
Wesenheit erfaßt und sich dazu in der Lage sieht, auch den Gegenstand in seiner originären<br />
Wahrheit zu erkennen. Der folgende Abschnitt wird <strong>als</strong>o aus einer zweifachen, doch gleichzeitig in<br />
der Tiefe zusammenhängenden Perspektive, nämlich derjenigen der Ästhetik und der Gnoseologie,<br />
entstehen.<br />
1. 3. <strong>Die</strong> Seele <strong>als</strong> Abbild der Wahrheit<br />
Was von Gott in den Geschöpfen der sinnlich erfaßbaren Welt höchstens zu finden ist, ist<br />
ein Abglanz <strong>des</strong> Schöpfers <strong>als</strong> ihrer bewirkenden, exemplarisch-formalen und finalen Ursache. Aber<br />
wenn der Mensch den Blick auf seine eigene Seele richtet, dann findet er darin etwas mehr <strong>als</strong> eine<br />
bloße Spur Gottes: Er findet dort <strong>des</strong>sen Abbild. Was nun bewirkt, daß wir in der Seele nicht nur<br />
einen Schatten, eine Spur, sondern Gott selbst finden, das ist der Umstand, daß Er nicht allein ihre<br />
Ursache ist, sondern zudem noch ihr Gegenstand. Den göttlichen Zueignungen gemäß dürfte man<br />
daher sagen, erst im Inneren der menschlichen Seele erreichen transzendentale Einheit, Wahrheit,<br />
Güte und Schönheit einen viel helleren Abglanz <strong>als</strong> in der Wirklichkeit <strong>des</strong> sinnlich wahrnehmbaren<br />
Seienden.<br />
Hier erscheint auch der <strong>als</strong> intellectus agens bekannte Habitus der menschlichen Seele. Bei<br />
ihm handelt es sich um die Fähigkeit, aus dem sinnlich Wahrgenommenen den intelligiblen Aspekt<br />
(die species) <strong>des</strong> Seienden zu abstrahieren, der danach vom intellectus possibilis aufgenommen<br />
wird. Letzterer ist jedoch nicht von einer völligen Passivität bestimmt, weil er sich zum intelligiblen<br />
Aspekt zurückwenden muß, der im sinnlichen Abbild vorhanden ist; und mit Hilfe <strong>des</strong> intellectus<br />
agens muß er diesen annehmen und von dieser intelligiblen Spezies her beurteilen. 357 Genauso wie<br />
der intellectus possibilis nicht völlig passiv bleibt, ist auch der intellectus agens nicht vollkommener<br />
Akt, zumal er seine Tätigkeit gar nicht auszuüben vermag, falls ihm der Gegenstand nicht<br />
357 II Sent, d. 24, p. 1, a. 2, q. 4 concl. (II, 569 a): “... intellectus agens ordinatur ad abstrahendum; nec<br />
intellectum possibilis est pure passivus; habet enim supra speciem existentem in phantasmate se convertere, et<br />
convertendo per auxilium intellectus agentis illam suscipere, et de ea iudicare”.<br />
143