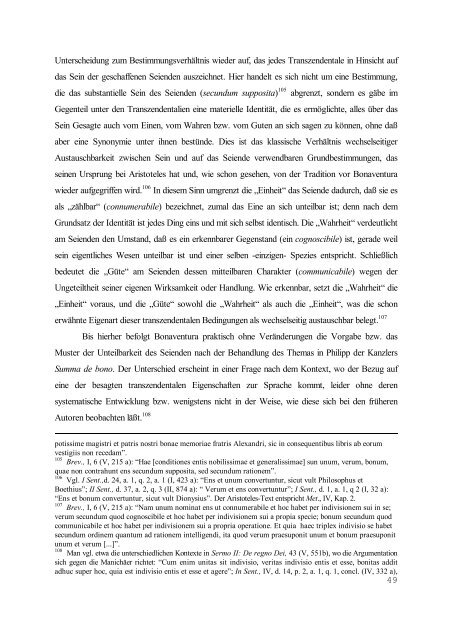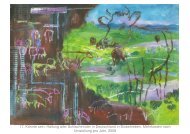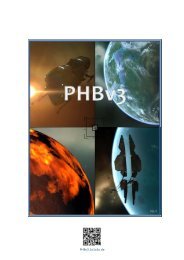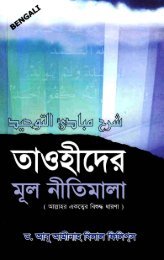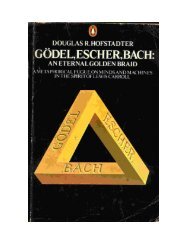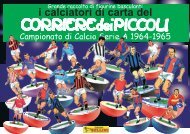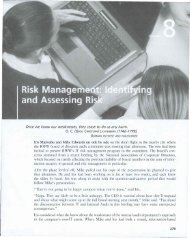1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Unterscheidung zum Bestimmungsverhältnis wieder auf, das je<strong>des</strong> Transzendentale in Hinsicht auf<br />
das Sein der geschaffenen Seienden auszeichnet. Hier handelt es sich nicht um eine Bestimmung,<br />
die das substantielle Sein <strong>des</strong> Seienden (secundum supposita) 105 abgrenzt, sondern es gäbe im<br />
Gegenteil unter den <strong>Transzendentalien</strong> eine materielle Identität, die es ermöglichte, alles über das<br />
Sein Gesagte auch vom Einen, vom Wahren bzw. vom Guten an sich sagen zu können, ohne daß<br />
aber eine Synonymie unter ihnen bestünde. <strong>Die</strong>s ist das klassische Verhältnis wechselseitiger<br />
Austauschbarkeit zwischen Sein und auf das Seiende verwendbaren Grundbestimmungen, das<br />
seinen Ursprung bei Aristoteles hat und, wie schon gesehen, von der Tradition vor Bonaventura<br />
wieder aufgegriffen wird. 106 In diesem Sinn umgrenzt die „Einheit“ das Seiende dadurch, daß sie es<br />
<strong>als</strong> „zählbar“ (connumerabile) bezeichnet, zumal das Eine an sich unteilbar ist; denn nach dem<br />
Grundsatz der Identität ist je<strong>des</strong> Ding eins und mit sich selbst identisch. <strong>Die</strong> „Wahrheit“ verdeutlicht<br />
am Seienden den Umstand, daß es ein erkennbarer Gegenstand (ein cognoscibile) ist, gerade weil<br />
sein eigentliches Wesen unteilbar ist und einer selben -einzigen- Spezies entspricht. Schließlich<br />
bedeutet die „Güte“ am Seienden <strong>des</strong>sen mitteilbaren Charakter (communicabile) wegen der<br />
Ungeteiltheit seiner eigenen Wirksamkeit oder Handlung. Wie erkennbar, setzt die „Wahrheit“ die<br />
„Einheit“ voraus, und die „Güte“ sowohl die „Wahrheit“ <strong>als</strong> auch die „Einheit“, was die schon<br />
erwähnte Eigenart dieser transzendentalen Bedingungen <strong>als</strong> wechselseitig austauschbar belegt. 107<br />
Bis hierher befolgt Bonaventura praktisch ohne Veränderungen die Vorgabe bzw. das<br />
Muster der Unteilbarkeit <strong>des</strong> Seienden nach der Behandlung <strong>des</strong> Themas in Philipp der Kanzlers<br />
Summa de bono. Der Unterschied erscheint in einer Frage nach dem Kontext, wo der Bezug auf<br />
eine der besagten transzendentalen Eigenschaften zur Sprache kommt, leider ohne deren<br />
systematische Entwicklung bzw. wenigstens nicht in der Weise, wie diese sich bei den früheren<br />
Autoren beobachten läßt. 108<br />
potissime magistri et patris nostri bonae memoriae fratris Alexandri, sic in consequentibus libris ab eorum<br />
vestigiis non recedam”.<br />
105 Brev., I, 6 (V, 215 a): “Hae [conditiones entis nobilissimae et generalissimae] sun unum, verum, bonum,<br />
quae non contrahunt ens secundum supposita, sed secundum rationem”.<br />
106 Vgl. I Sent.,d. 24, a. 1, q. 2, a. 1 (I, 423 a): “Ens et unum convertuntur, sicut vult Philosophus et<br />
Boethius”; II Sent., d. 37, a. 2, q. 3 (II, 874 a): “ Verum et ens convertuntur”; I Sent., d. 1, a. 1, q 2 (I, 32 a):<br />
“Ens et bonum convertuntur, sicut vult Dionysius”. Der Aristoteles-Text entspricht Met., IV, Kap. 2.<br />
107 Brev., I, 6 (V, 215 a): “Nam unum nominat ens ut connumerabile et hoc habet per indivisionem sui in se;<br />
verum secundum quod cognoscibile et hoc habet per indivisionem sui a propia specie; bonum secundum quod<br />
communicabile et hoc habet per indivisionem sui a propria operatione. Et quia haec triplex indivisio se habet<br />
secundum ordinem quantum ad rationem intelligendi, ita quod verum praesuponit unum et bonum praesuponit<br />
unum et verum [...]”.<br />
108 Man vgl. etwa die unterschiedlichen Kontexte in Sermo II: De regno Dei, 43 (V, 551b), wo die Argumentation<br />
sich gegen die Manichäer richtet: “Cum enim unitas sit indivisio, veritas indivisio entis et esse, bonitas addit<br />
adhuc super hoc, quia est indivisio entis et esse et agere”; In Sent., IV, d. 14, p. 2, a. 1, q. 1, concl. (IV, 332 a),<br />
49