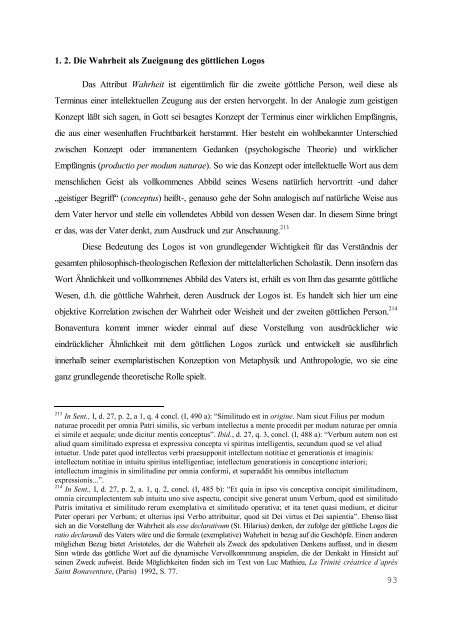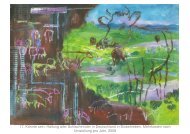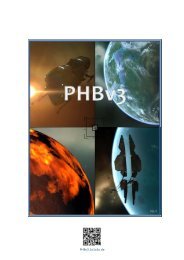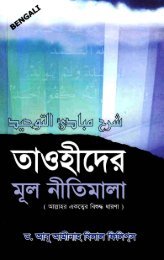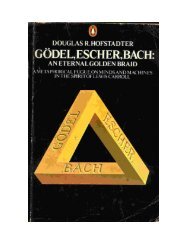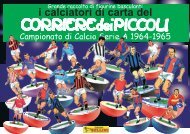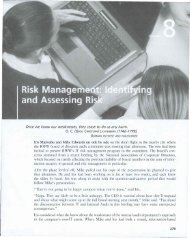1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. 2. <strong>Die</strong> Wahrheit <strong>als</strong> Zueignung <strong>des</strong> göttlichen Logos<br />
Das Attribut Wahrheit ist eigentümlich für die zweite göttliche Person, weil diese <strong>als</strong><br />
Terminus einer intellektuellen Zeugung aus der ersten hervorgeht. In der Analogie zum geistigen<br />
Konzept läßt sich sagen, in Gott sei besagtes Konzept der Terminus einer wirklichen Empfängnis,<br />
die aus einer wesenhaften Fruchtbarkeit herstammt. Hier besteht ein wohlbekannter Unterschied<br />
zwischen Konzept oder immanentem Gedanken (psychologische Theorie) und wirklicher<br />
Empfängnis (productio per modum naturae). So wie das Konzept oder intellektuelle Wort aus dem<br />
menschlichen Geist <strong>als</strong> vollkommenes Abbild seines Wesens natürlich hervortritt -und daher<br />
„geistiger Begriff“ (conceptus) heißt-, genauso gehe der Sohn analogisch auf natürliche Weise aus<br />
dem Vater hervor und stelle ein vollendetes Abbild von <strong>des</strong>sen Wesen dar. In diesem Sinne bringt<br />
er das, was der Vater denkt, zum Ausdruck und zur Anschauung. 213<br />
<strong>Die</strong>se Bedeutung <strong>des</strong> Logos ist von grundlegender Wichtigkeit für das Verständnis der<br />
gesamten philosophisch-<strong>theologische</strong>n Reflexion der mittelalterlichen Scholastik. Denn insofern das<br />
Wort Ähnlichkeit und vollkommenes Abbild <strong>des</strong> Vaters ist, erhält es von Ihm das gesamte göttliche<br />
Wesen, d.h. die göttliche Wahrheit, deren Ausdruck der Logos ist. Es handelt sich hier um eine<br />
objektive Korrelation zwischen der Wahrheit oder Weisheit und der zweiten göttlichen Person. 214<br />
Bonaventura kommt immer wieder einmal auf diese Vorstellung von ausdrücklicher wie<br />
eindrücklicher Ähnlichkeit mit dem göttlichen Logos zurück und entwickelt sie ausführlich<br />
innerhalb seiner exemplaristischen Konzeption von Metaphysik und Anthropologie, wo sie eine<br />
ganz grundlegende theoretische Rolle spielt.<br />
213 In Sent., I, d. 27, p. 2, a 1, q. 4 concl. (I, 490 a): “Similitudo est in origine. Nam sicut Filius per modum<br />
naturae procedit per omnia Patri similis, sic verbum intellectus a mente procedit per modum naturae per omnia<br />
ei simile et aequale; unde dicitur mentis conceptus”. Ibid., d. 27, q. 3, concl. (I, 488 a): “Verbum autem non est<br />
aliud quam similitudo expressa et expressiva concepta vi spiritus intelligentis, secundum quod se vel aliud<br />
intuetur. Unde patet quod intellectus verbi praesupponit intellectum notitiae et generationis et imaginis:<br />
intellectum notitiae in intuitu spiritus intelligentiae; intellectum generationis in conceptione interiori;<br />
intellectum imaginis in similitudine per omnia conformi, et superaddit his omnibus intellectum<br />
expressionis...”.<br />
214 In Sent., I, d. 27, p. 2, a. 1, q. 2, concl. (I, 485 b): “Et quia in ipso vis conceptiva concipit similitudinem,<br />
omnia circumplectentem sub intuitu uno sive aspectu, concipit sive generat unum Verbum, quod est similitudo<br />
Patris imitativa et similitudo rerum exemplativa et similitudo operativa; et ita tenet quasi medium, et dicitur<br />
Pater operari per Verbum; et ulterius ipsi Verbo attribuitur, quod sit Dei virtus et Dei sapientia”. Ebenso lässt<br />
sich an die Vorstellung der Wahrheit <strong>als</strong> esse declarativum (St. Hilarius) denken, der zufolge der göttliche Logos die<br />
ratio declarandi <strong>des</strong> Vaters wäre und die formale (exemplative) Wahrheit in bezug auf die Geschöpfe. Einen anderen<br />
möglichen Bezug bietet Aristoteles, der die Wahrheit <strong>als</strong> Zweck <strong>des</strong> spekulativen Denkens auffasst, und in diesem<br />
Sinn würde das göttliche Wort auf die dynamische Vervollkommnung anspielen, die der Denkakt in Hinsicht auf<br />
seinen Zweck aufweist. Beide Möglichkeiten finden sich im Text von Luc Mathieu, La Trinité créatrice d’après<br />
Saint Bonaventure, (Paris) 1992, S. 77.<br />
93