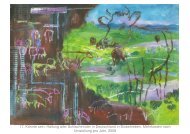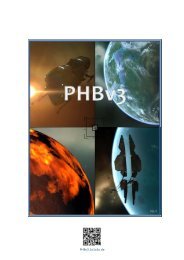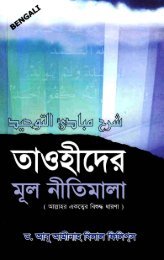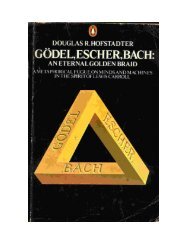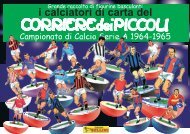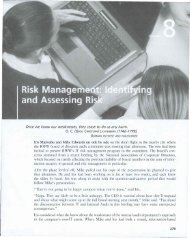1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auf die Vorsokratiker folgte ein Denkansatz, der das Sein der Wesen aus einer<br />
Unterscheidung von Materie und Form zu erklären vermochte. So wurden die wahrnehmenden<br />
Substanzen aufgrund einer Rückführung auf deren wesentliche Teile begriffen. Der Ursprung der<br />
Dinge lag <strong>als</strong>o nicht mehr z.B. in Freundschaft oder Zwietracht (Empedokles), sondern in Ursachen<br />
mit einem höheren Grad der Allgemeinheit, wie etwa den platonischen Ideen. <strong>Die</strong>se Form, den<br />
Ursprung der Wesen zu denken, bedeutet gewiß einen Fortschritt gegenüber dem früheren<br />
Verfahren, das die materielle Wirklichkeit allein aus einer Sicht wahrnehmender Subjekte<br />
betrachtete. Dennoch weist sie denselben Nachteil auf wie ersteres. Denn das Sein wird unter einem<br />
einzelnen Aspekt betrachtet, der es dann bestimmt. Das Sein ist immer noch dieses Sein.<br />
Demzufolge sind auch die Ursachen, denen sie die Erzeugung der Wesen zuteilen, ebenso<br />
vereinzelt.<br />
Eine dritte Betrachtungsweise sucht den Ursprung <strong>des</strong> Seienden nicht mehr in der<br />
Erzeugung, sondern in der Schöpfung. Thomas spricht hier von „einigen Denkern“, die das Sein <strong>als</strong><br />
Seien<strong>des</strong> gedacht haben (ens inquantum est ens) und dabei eine Kausalität <strong>des</strong> Seienden <strong>als</strong><br />
Seien<strong>des</strong> (entia) in Betracht zogen. Da es allein der Vorstellung von der Schöpfung möglich ist, das<br />
Sein in absolutem Sinn geschaffen zu denken, sind diese Denker auch die einzigen, die eine<br />
universelle Ursache <strong>des</strong> <strong>Seins</strong> angenommen haben: Gott. 77<br />
1. 1. Aristoteles und die kategorialen Genera<br />
Obwohl gesichert ist, daß auch die Nachwirkungen <strong>des</strong> Denkens von Avicenna, Boethius<br />
und Dionysius entscheidend gewesen sind, bleibt das Corpus aristotelicum doch zweifellos die<br />
Hauptquelle für die mittelalterliche Lehre von den <strong>Transzendentalien</strong>. Nach Aristoteles wird das<br />
Sein in vielfacher Weise gesagt, und diese Vielfalt findet ihren Ausdruck den zehn höchsten Genera,<br />
die er <strong>als</strong> Kategorien bezeichnet und dabei von den zehn Gegensatzpaaren der Pythagoräer sowie<br />
den fünf erhabensten Gattungen in Platons Sophistes ausgeht. <strong>Die</strong> Kategorien bestimmen danach<br />
das Sein, weil sie es auf ein bestimmtes Wesen bzw. eine solche Wesensart eingrenzen, zunächst<br />
durch die <strong>Seins</strong>weise der Substanz und dann durch die <strong>Seins</strong>weise der Akzidentien. <strong>Die</strong> Substanz<br />
77 Summ. Theol., I, 44, 2: “Et ulterius aliqui erexerunt se ad considerandum ens inquantum est ens: et<br />
consideraverunt causam rerum, non solum secundum quod sunt haec vel talia, sed secundum quod sunt entia.<br />
Hoc igitur quod est causa rerum inquantum sunt entia, oportet esse causam rerum, non solum secundum quod<br />
sunt talia per formas accidentales, nec secundum quod sunt haec per formas substantiales, sed etiam secundum<br />
37