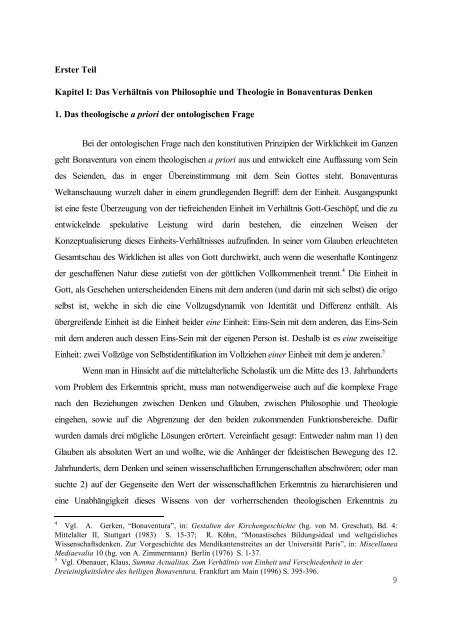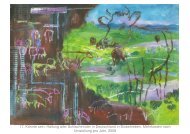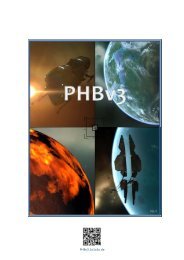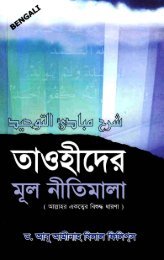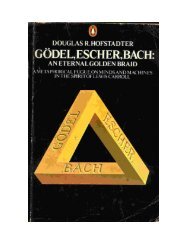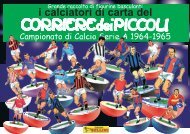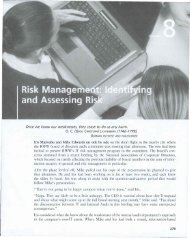1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erster Teil<br />
Kapitel I: Das Verhältnis von Philosophie und Theologie in Bonaventuras Denken<br />
1. Das <strong>theologische</strong> a priori der <strong>onto</strong>logischen Frage<br />
Bei der <strong>onto</strong>logischen Frage nach den konstitutiven Prinzipien der Wirklichkeit im Ganzen<br />
geht Bonaventura von einem <strong>theologische</strong>n a priori aus und entwickelt eine Auffassung vom Sein<br />
<strong>des</strong> Seienden, das in enger Übereinstimmung mit dem Sein Gottes steht. Bonaventuras<br />
Weltanschauung wurzelt daher in einem grundlegenden Begriff: dem der Einheit. Ausgangspunkt<br />
ist eine feste Überzeugung von der tiefreichenden Einheit im Verhältnis Gott-Geschöpf, und die zu<br />
entwickelnde spekulative Leistung wird darin bestehen, die einzelnen Weisen der<br />
Konzeptualisierung dieses Einheits-Verhältnisses aufzufinden. In seiner vom Glauben erleuchteten<br />
Gesamtschau <strong>des</strong> Wirklichen ist alles von Gott durchwirkt, auch wenn die wesenhafte Kontingenz<br />
der geschaffenen Natur diese zutiefst von der göttlichen Vollkommenheit trennt. 4 <strong>Die</strong> Einheit in<br />
Gott, <strong>als</strong> Geschehen unterscheidenden Einens mit dem anderen (und darin mit sich selbst) die origo<br />
selbst ist, welche in sich die eine Vollzugsdynamik von Identität und Differenz enthält. Als<br />
übergreifende Einheit ist die Einheit beider eine Einheit: Eins-Sein mit dem anderen, das Eins-Sein<br />
mit dem anderen auch <strong>des</strong>sen Eins-Sein mit der eigenen Person ist. Deshalb ist es eine zweiseitige<br />
Einheit: zwei Vollzüge von Selbstidentifikation im Vollziehen einer Einheit mit dem je anderen. 5<br />
Wenn man in Hinsicht auf die mittelalterliche Scholastik um die Mitte <strong>des</strong> 13. Jahrhunderts<br />
vom Problem <strong>des</strong> Erkenntnis spricht, muss man notwendigerweise auch auf die komplexe Frage<br />
nach den Beziehungen zwischen Denken und Glauben, zwischen Philosophie und Theologie<br />
eingehen, sowie auf die Abgrenzung der den beiden zukommenden Funktionsbereiche. Dafür<br />
wurden dam<strong>als</strong> drei mögliche Lösungen erörtert. Vereinfacht gesagt: Entweder nahm man 1) den<br />
Glauben <strong>als</strong> absoluten Wert an und wollte, wie die Anhänger der fideistischen Bewegung <strong>des</strong> 12.<br />
Jahrhunderts, dem Denken und seinen wissenschaftlichen Errungenschaften abschwören; oder man<br />
suchte 2) auf der Gegenseite den Wert der wissenschaftlichen Erkenntnis zu hierarchisieren und<br />
eine Unabhängigkeit dieses Wissens von der vorherrschenden <strong>theologische</strong>n Erkenntnis zu<br />
4<br />
Vgl. A. Gerken, “Bonaventura”, in: Gestalten der Kirchengeschichte (hg. von M. Greschat), Bd. 4:<br />
Mittelalter II, Stuttgart (1983) S. 15-37; R. Köhn, “Monastisches Bildungsideal und weltgeisliches<br />
Wissenschaftsdenken. Zur Vorgeschichte <strong>des</strong> Mendikantenstreites an der Universität Paris”, in: Miscellanea<br />
Mediaevalia 10 (hg. von A. Zimmermann) Berlin (1976) S. 1-37.<br />
5 Vgl. Obenauer, Klaus, Summa Actualitas. Zum Verhältnis von Einheit und Verschiedenheit in der<br />
Dreieinigkeitslehre <strong>des</strong> heiligen Bonaventura, Frankfurt am Main (1996) S. 395-396.<br />
9