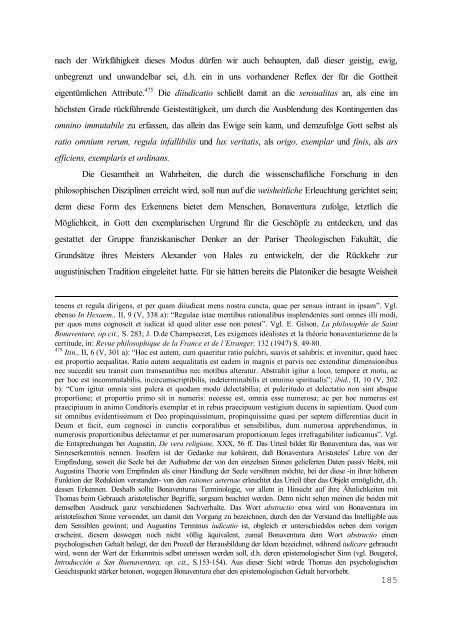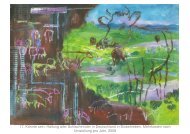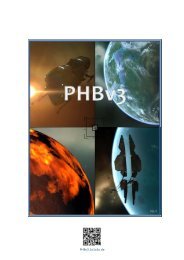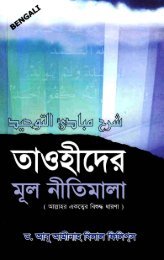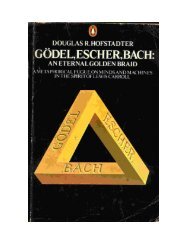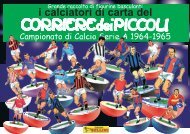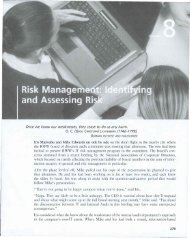1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nach der Wirkfähigkeit dieses Modus dürfen wir auch behaupten, daß dieser geistig, ewig,<br />
unbegrenzt und unwandelbar sei, d.h. ein in uns vorhandener Reflex der für die Gottheit<br />
eigentümlichen Attribute. 475 <strong>Die</strong> diiudicatio schließt damit an die sensualitas an, <strong>als</strong> eine im<br />
höchsten Grade rückführende Geistestätigkeit, um durch die Ausblendung <strong>des</strong> Kontingenten das<br />
omnino immutabile zu erfassen, das allein das Ewige sein kann, und demzufolge Gott selbst <strong>als</strong><br />
ratio omnium rerum, regula infallibilis und lux veritatis, <strong>als</strong> origo, exemplar und finis, <strong>als</strong> ars<br />
efficiens, exemplaris et ordinans.<br />
<strong>Die</strong> Gesamtheit an Wahrheiten, die durch die wissenschaftliche Forschung in den<br />
philosophischen Disziplinen erreicht wird, soll nun auf die weisheitliche Erleuchtung gerichtet sein;<br />
denn diese Form <strong>des</strong> Erkennens bietet dem Menschen, Bonaventura zufolge, letztlich die<br />
Möglichkeit, in Gott den exemplarischen Urgrund für die Geschöpfe zu entdecken, und das<br />
gestattet der Gruppe franziskanischer Denker an der Pariser Theologischen Fakultät, die<br />
Grundsätze ihres Meisters Alexander von Hales zu entwickeln, der die Rückkehr zur<br />
augustinischen Tradition eingeleitet hatte. Für sie hätten bereits die Platoniker die besagte Weisheit<br />
tenens et regula dirigens, et per quam diiudicat mens nostra cuncta, quae per sensus intrant in ipsam”. Vgl.<br />
ebenso In Hexaem., II, 9 (V, 338 a): “Regulae istae mentibus rationalibus insplendentes sunt omnes illi modi,<br />
per quos mens cognoscit et iudicat id quod aliter esse non potest”. Vgl. E. Gilson, La philosophie de Saint<br />
Bonaventure, op.cit., S. 283; J. D.de Champsecret, Les exigences idèalistes et la théorie bonaventurienne de la<br />
certitude, in: Revue philosophique de la France et de l’Etranger, 132 (1947) S. 49-80.<br />
475 Itin., II, 6 (V, 301 a): “Hoc est autem, cum quaeritur ratio pulchri, suavis et salubris: et invenitur, quod haec<br />
est proportio aequalitas. Ratio autem aequalitatis est eadem in magnis et parvis nec extenditur dimensionibus<br />
nec succedit seu transit cum transeuntibus nec motibus alteratur. Abstrahit igitur a loco, tempore et motu, ac<br />
per hoc est incommutabilis, incircumscriptibilis, indeterminabilis et omnino spiritualis”; ibid., II, 10 (V, 302<br />
b): “Cum igitur omnia sint pulcra et quodam modo delectabilia; et pulcritudo et delectatio non sint absque<br />
proportione; et proportio primo sit in numeris: necesse est, omnia esse numerosa; ac per hoc numerus est<br />
praecipiuum in animo Conditoris exemplar et in rebus praecipuum vestigium ducens in sapientiam. Quod cum<br />
sit omnibus evidentissimum et Deo propinquissimum, propinquissime quasi per septem differentias ducit in<br />
Deum et facit, eum cognosci in cunctis corporalibus et sensibilibus, dum numerosa apprehendimus, in<br />
numerosis proportionibus delectamur et per numerosarum proportionum leges irrefragabiliter iudicamus”. Vgl.<br />
die Entsprechungen bei Augustin, De vera religione, XXX, 56 ff. Das Urteil bildet für Bonaventura das, was wir<br />
Sinneserkenntnis nennen. Insofern ist der Gedanke nur kohärent, daß Bonaventura Aristoteles' Lehre von der<br />
Empfindung, soweit die Seele bei der Aufnahme der von den einzelnen Sinnen gelieferten Daten passiv bleibt, mit<br />
Augustins Theorie vom Empfinden <strong>als</strong> einer Handlung der Seele versöhnen möchte, bei der diese -in ihrer höheren<br />
Funktion der Reduktion verstanden- von den rationes aeternae erleuchtet das Urteil über das Objekt ermöglicht, d.h.<br />
<strong>des</strong>sen Erkennen. Deshalb sollte Bonaventuras Terminologie, vor allem in Hinsicht auf ihre Ähnlichkeiten mit<br />
Thomas beim Gebrauch aristotelischer Begriffe, sorgsam beachtet werden. Denn nicht selten meinen die beiden mit<br />
demselben Ausdruck ganz verschiedenen Sachverhalte. Das Wort abstractio etwa wird von Bonaventura im<br />
aristotelischen Sinne verwendet, um damit den Vorgang zu bezeichnen, durch den der Verstand das Intelligible aus<br />
dem Sensiblen gewinnt; und Augustins Terminus iudicatio ist, obgleich er unterschiedslos neben dem vorigen<br />
erscheint, diesem <strong>des</strong>wegen noch nicht völlig äquivalent, zumal Bonaventura dem Wort abstractio einen<br />
psychologischen Gehalt beilegt, der den Prozeß der Herausbildung der Ideen bezeichnet, während iudicare gebraucht<br />
wird, wenn der Wert der Erkenntnis selbst umrissen werden soll, d.h. deren epistemologischer Sinn (vgl. Bougerol,<br />
Introducción a San Buenaventura, op. cit., S.153-154). Aus dieser Sicht würde Thomas den psychologischen<br />
Gesichtspunkt stärker betonen, wogegen Bonaventura eher den epistemologischen Gehalt hervorhebt.<br />
185