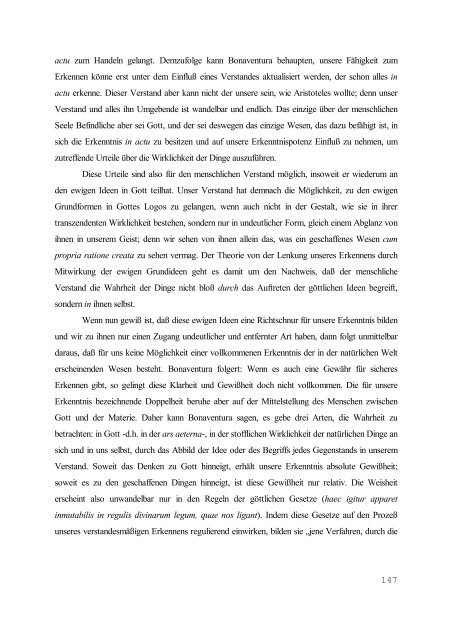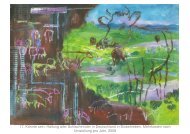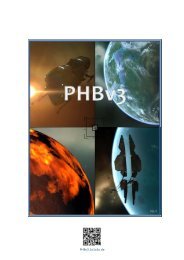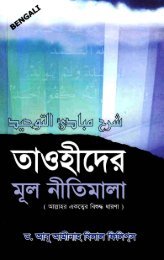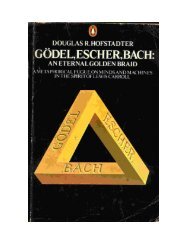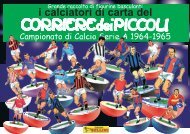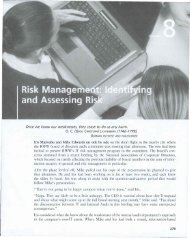1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
actu zum Handeln gelangt. Demzufolge kann Bonaventura behaupten, unsere Fähigkeit zum<br />
Erkennen könne erst unter dem Einfluß eines Verstan<strong>des</strong> aktualisiert werden, der schon alles in<br />
actu erkenne. <strong>Die</strong>ser Verstand aber kann nicht der unsere sein, wie Aristoteles wollte; denn unser<br />
Verstand und alles ihn Umgebende ist wandelbar und endlich. Das einzige über der menschlichen<br />
Seele Befindliche aber sei Gott, und der sei <strong>des</strong>wegen das einzige Wesen, das dazu befähigt ist, in<br />
sich die Erkenntnis in actu zu besitzen und auf unsere Erkenntnispotenz Einfluß zu nehmen, um<br />
zutreffende Urteile über die Wirklichkeit der Dinge auszuführen.<br />
<strong>Die</strong>se Urteile sind <strong>als</strong>o für den menschlichen Verstand möglich, insoweit er wiederum an<br />
den ewigen Ideen in Gott teilhat. Unser Verstand hat demnach die Möglichkeit, zu den ewigen<br />
Grundformen in Gottes Logos zu gelangen, wenn auch nicht in der Gestalt, wie sie in ihrer<br />
transzendenten Wirklichkeit bestehen, sondern nur in undeutlicher Form, gleich einem Abglanz von<br />
ihnen in unserem Geist; denn wir sehen von ihnen allein das, was ein geschaffenes Wesen cum<br />
propria ratione creata zu sehen vermag. Der Theorie von der Lenkung unseres Erkennens durch<br />
Mitwirkung der ewigen Grundideen geht es damit um den Nachweis, daß der menschliche<br />
Verstand die Wahrheit der Dinge nicht bloß durch das Auftreten der göttlichen Ideen begreift,<br />
sondern in ihnen selbst.<br />
Wenn nun gewiß ist, daß diese ewigen Ideen eine Richtschnur für unsere Erkenntnis bilden<br />
und wir zu ihnen nur einen Zugang undeutlicher und entfernter Art haben, dann folgt unmittelbar<br />
daraus, daß für uns keine Möglichkeit einer vollkommenen Erkenntnis der in der natürlichen Welt<br />
erscheinenden Wesen besteht. Bonaventura folgert: Wenn es auch eine Gewähr für sicheres<br />
Erkennen gibt, so gelingt diese Klarheit und Gewißheit doch nicht vollkommen. <strong>Die</strong> für unsere<br />
Erkenntnis bezeichnende Doppelheit beruhe aber auf der Mittelstellung <strong>des</strong> Menschen zwischen<br />
Gott und der Materie. Daher kann Bonaventura sagen, es gebe drei Arten, die Wahrheit zu<br />
betrachten: in Gott -d.h. in der ars aeterna-, in der stofflichen Wirklichkeit der natürlichen Dinge an<br />
sich und in uns selbst, durch das Abbild der Idee oder <strong>des</strong> Begriffs je<strong>des</strong> Gegenstands in unserem<br />
Verstand. Soweit das Denken zu Gott hinneigt, erhält unsere Erkenntnis absolute Gewißheit;<br />
soweit es zu den geschaffenen Dingen hinneigt, ist diese Gewißheit nur relativ. <strong>Die</strong> Weisheit<br />
erscheint <strong>als</strong>o unwandelbar nur in den Regeln der göttlichen Gesetze (haec igitur apparet<br />
inmutabilis in regulis divinarum legum, quae nos ligant). Indem diese Gesetze auf den Prozeß<br />
unseres verstan<strong>des</strong>mäßigen Erkennens regulierend einwirken, bilden sie „jene Verfahren, durch die<br />
147