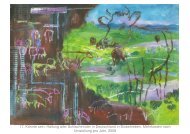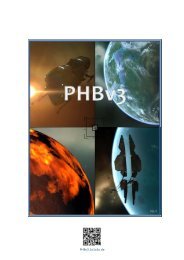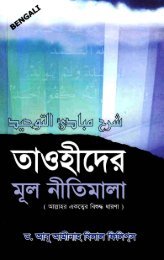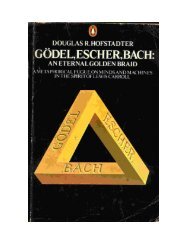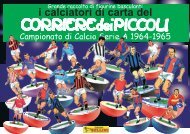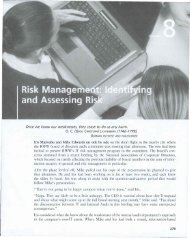1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anhängern <strong>des</strong> christlichen Glaubens zugänglich, und <strong>des</strong>halb nicht allen Menschen. Doch würde<br />
uns Bonaventura gewiß entgegnen, daß der christliche Glaube in seinen Wurzeln universell ist und<br />
ein Nicht-Christ sich daher im Irrtum befindet. <strong>Die</strong>se Antwort enthielte erneut das schon<br />
angesprochene <strong>theologische</strong> a priori. Und wir hätten damit zwei Möglichkeiten: entweder<br />
Bonaventuras Denken zu übergehen, weil letztlich alles grundlegend auf einem ersten Prinzip<br />
beruht, das apriorisch und ohne weiteres mit dem Gott der biblischen Offenbarung gleichgesetzt<br />
wird (womit gleichfalls viele andere Denker nicht nur <strong>des</strong> Mittelalters übergangen werden müßten);<br />
oder aber die Mühe auf uns zu nehmen, den einzelnen Strukturen seines Denkens schrittweise zu<br />
folgen und eine Konzeptualisierung seiner <strong>theologische</strong>n Lehre zu versuchen, wobei wir Bedeutung<br />
und Zweck, die darin bestimmte eigentlich philosophische Elemente erhalten, wie bei der Lehre von<br />
den <strong>Transzendentalien</strong>, erfassen sollten.<br />
Andererseits besteht ein zweiter Grund darin, daß der Glaube nicht auf die Erkenntnis<br />
Gottes <strong>als</strong> transzendenter körperloser Substanz, sondern <strong>als</strong> personaler Trinität verweist. Und<br />
genau dazu kann die natürliche Vernunft keinen Zugang mehr haben, weil dort ein Mysterium<br />
vorliegt, das sich erst im Glaubensdogma erschließt. Es ließe sich <strong>als</strong>o sagen, der Glaube komme<br />
hier der Vernunft zu Hilfe, aber nicht so sehr, weil diese unzulänglich und vor Irrtümern nicht<br />
geschützt sei, sondern da sich der zu behandelnde Gegenstand schlicht und einfach außerhalb ihrer<br />
natürlichen Möglichkeiten befindet, ein Argument, das nicht mehr allein in den Bereich der<br />
Theologen gehört, sondern diesen schon überschreitet. Und hier können sich wiederum zwei<br />
Optionen ergeben: entweder Bonaventura abtun, weil wir -wie Wittgenstein sagen würde- über das<br />
nicht reden sollen, was wir nicht erkennen können (die Einstellung <strong>des</strong> heute vorherrschenden<br />
logischen Positivismus, womit wir wieder viele andere Denker übergehen müßten); oder uns der<br />
Möglichkeit annähern, eine (philosophische) Vernunft zu postulieren, die offen wäre für das<br />
Verständnis der Wirklichkeit aus interdisziplinären Sichtweisen, die sich in der Verwendung <strong>des</strong><br />
jedem jeweils Eigentümlichen wechselseitig ergänzen, und -wenn auch nur methodisch, wie beim<br />
hyperbolischen Zweifel der Cartesianer- das intellektuelle Gefängnis etwas zu verlassen, in das sich<br />
eine übertriebene Nutzung <strong>des</strong> methodischen Paradigmas schließlich verwandeln kann.<br />
<strong>Die</strong> Weisheit, welche die mittelalterlichen Denker von Aristoteles übernommen hatten, war<br />
weder reiner Verstand noch reine Vernunft, sondern umfaßte beide und überschritt auch beide.<br />
Denn der Verstand ist der Habitus der Prinzipien, und die Verständigen sind die, welche die<br />
Prinzipien, die Ursachen und die Erklärungen für die Dinge rasch und richtig erfassen. <strong>Die</strong> Vernunft<br />
189