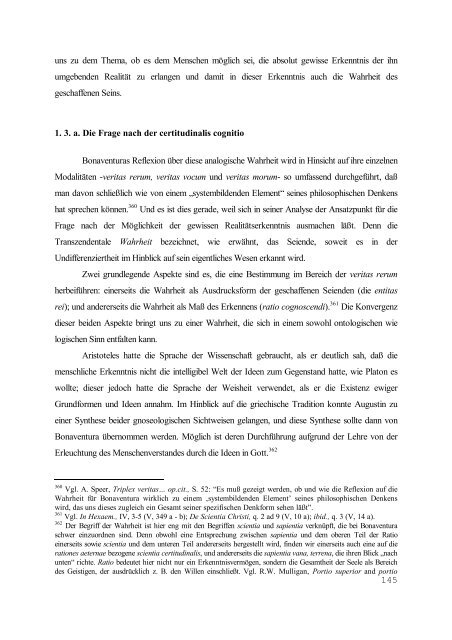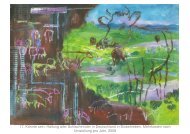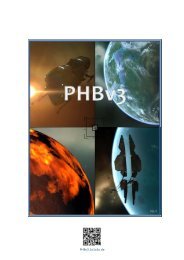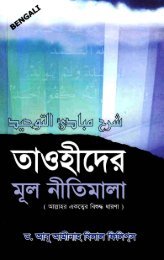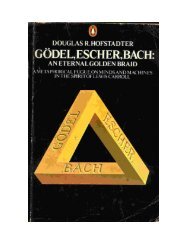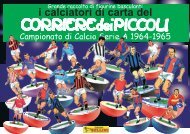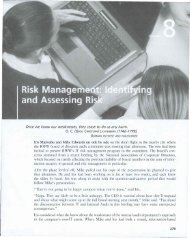1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
uns zu dem Thema, ob es dem Menschen möglich sei, die absolut gewisse Erkenntnis der ihn<br />
umgebenden Realität zu erlangen und damit in dieser Erkenntnis auch die Wahrheit <strong>des</strong><br />
geschaffenen <strong>Seins</strong>.<br />
1. 3. a. <strong>Die</strong> Frage nach der certitudinalis cognitio<br />
Bonaventuras Reflexion über diese analogische Wahrheit wird in Hinsicht auf ihre einzelnen<br />
Modalitäten -veritas rerum, veritas vocum und veritas morum- so umfassend durchgeführt, daß<br />
man davon schließlich wie von einem „systembildenden Element“ seines philosophischen Denkens<br />
hat sprechen können. 360 Und es ist dies gerade, weil sich in seiner Analyse der Ansatzpunkt für die<br />
Frage nach der Möglichkeit der gewissen Realitätserkenntnis ausmachen läßt. Denn die<br />
Transzendentale Wahrheit bezeichnet, wie erwähnt, das Seiende, soweit es in der<br />
Undifferenziertheit im Hinblick auf sein eigentliches Wesen erkannt wird.<br />
Zwei grundlegende Aspekte sind es, die eine Bestimmung im Bereich der veritas rerum<br />
herbeiführen: einerseits die Wahrheit <strong>als</strong> Ausdrucksform der geschaffenen Seienden (die entitas<br />
rei); und andererseits die Wahrheit <strong>als</strong> Maß <strong>des</strong> Erkennens (ratio cognoscendi). 361 <strong>Die</strong> Konvergenz<br />
dieser beiden Aspekte bringt uns zu einer Wahrheit, die sich in einem sowohl <strong>onto</strong>logischen wie<br />
logischen Sinn entfalten kann.<br />
Aristoteles hatte die Sprache der Wissenschaft gebraucht, <strong>als</strong> er deutlich sah, daß die<br />
menschliche Erkenntnis nicht die intelligibel Welt der Ideen zum Gegenstand hatte, wie Platon es<br />
wollte; dieser jedoch hatte die Sprache der Weisheit verwendet, <strong>als</strong> er die Existenz ewiger<br />
Grundformen und Ideen annahm. Im Hinblick auf die griechische Tradition konnte Augustin zu<br />
einer Synthese beider gnoseologischen Sichtweisen gelangen, und diese Synthese sollte dann von<br />
Bonaventura übernommen werden. Möglich ist deren Durchführung aufgrund der Lehre von der<br />
Erleuchtung <strong>des</strong> Menschenverstan<strong>des</strong> durch die Ideen in Gott. 362<br />
360 Vgl. A. Speer, Triplex veritas… op.cit., S. 52: “Es muß gezeigt werden, ob und wie die Reflexion auf die<br />
Wahrheit für Bonaventura wirklich zu einem ‚systembildenden Element’ seines philosophischen Denkens<br />
wird, das uns dieses zugleich ein Gesamt seiner spezifischen Denkform sehen läßt”.<br />
361 Vgl. In Hexaem., IV, 3-5 (V, 349 a - b); De Scientia Christi, q. 2 ad 9 (V, 10 a); ibid., q. 3 (V, 14 a).<br />
362 Der Begriff der Wahrheit ist hier eng mit den Begriffen scientia und sapientia verknüpft, die bei Bonaventura<br />
schwer einzuordnen sind. Denn obwohl eine Entsprechung zwischen sapientia und dem oberen Teil der Ratio<br />
einerseits sowie scientia und dem unteren Teil andererseits hergestellt wird, finden wir einerseits auch eine auf die<br />
rationes aeternae bezogene scientia certitudinalis, und andererseits die sapientia vana, terrena, die ihren Blick „nach<br />
unten“ richte. Ratio bedeutet hier nicht nur ein Erkenntnisvermögen, sondern die Gesamtheit der Seele <strong>als</strong> Bereich<br />
<strong>des</strong> Geistigen, der ausdrücklich z. B. den Willen einschließt. Vgl. R.W. Mulligan, Portio superior and portio<br />
145