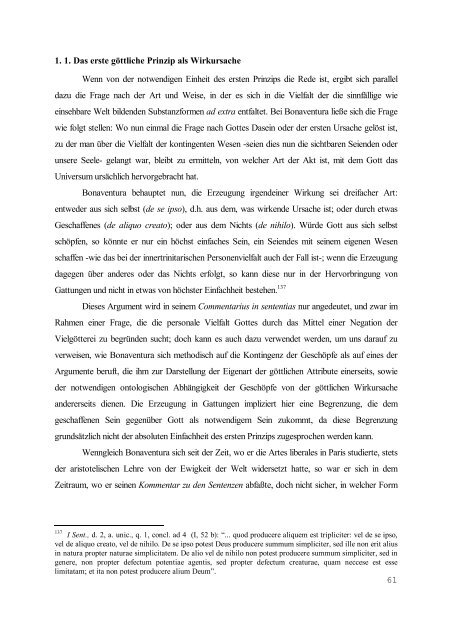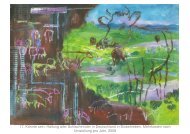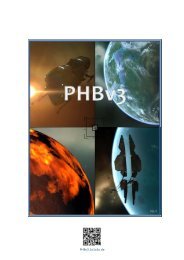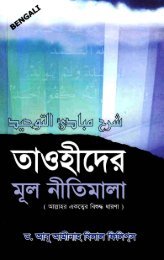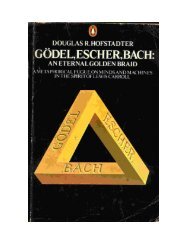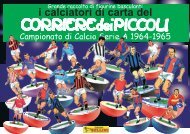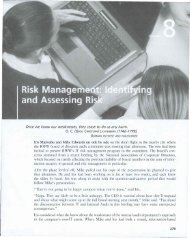1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. 1. Das erste göttliche Prinzip <strong>als</strong> Wirkursache<br />
Wenn von der notwendigen Einheit <strong>des</strong> ersten Prinzips die Rede ist, ergibt sich parallel<br />
dazu die Frage nach der Art und Weise, in der es sich in die Vielfalt der die sinnfällige wie<br />
einsehbare Welt bildenden Substanzformen ad extra entfaltet. Bei Bonaventura ließe sich die Frage<br />
wie folgt stellen: Wo nun einmal die Frage nach Gottes Dasein oder der ersten Ursache gelöst ist,<br />
zu der man über die Vielfalt der kontingenten Wesen -seien dies nun die sichtbaren Seienden oder<br />
unsere Seele- gelangt war, bleibt zu ermitteln, von welcher Art der Akt ist, mit dem Gott das<br />
Universum ursächlich hervorgebracht hat.<br />
Bonaventura behauptet nun, die Erzeugung irgendeiner Wirkung sei dreifacher Art:<br />
entweder aus sich selbst (de se ipso), d.h. aus dem, was wirkende Ursache ist; oder durch etwas<br />
Geschaffenes (de aliquo creato); oder aus dem Nichts (de nihilo). Würde Gott aus sich selbst<br />
schöpfen, so könnte er nur ein höchst einfaches Sein, ein Seien<strong>des</strong> mit seinem eigenen Wesen<br />
schaffen -wie das bei der innertrinitarischen Personenvielfalt auch der Fall ist-; wenn die Erzeugung<br />
dagegen über anderes oder das Nichts erfolgt, so kann diese nur in der Hervorbringung von<br />
Gattungen und nicht in etwas von höchster Einfachheit bestehen. 137<br />
<strong>Die</strong>ses Argument wird in seinem Commentarius in sententias nur angedeutet, und zwar im<br />
Rahmen einer Frage, die die personale Vielfalt Gottes durch das Mittel einer Negation der<br />
Vielgötterei zu begründen sucht; doch kann es auch dazu verwendet werden, um uns darauf zu<br />
verweisen, wie Bonaventura sich methodisch auf die Kontingenz der Geschöpfe <strong>als</strong> auf eines der<br />
Argumente beruft, die ihm zur Darstellung der Eigenart der göttlichen Attribute einerseits, sowie<br />
der notwendigen <strong>onto</strong>logischen Abhängigkeit der Geschöpfe von der göttlichen Wirkursache<br />
andererseits dienen. <strong>Die</strong> Erzeugung in Gattungen impliziert hier eine Begrenzung, die dem<br />
geschaffenen Sein gegenüber Gott <strong>als</strong> notwendigem Sein zukommt, da diese Begrenzung<br />
grundsätzlich nicht der absoluten Einfachheit <strong>des</strong> ersten Prinzips zugesprochen werden kann.<br />
Wenngleich Bonaventura sich seit der Zeit, wo er die Artes liberales in Paris studierte, stets<br />
der aristotelischen Lehre von der Ewigkeit der Welt widersetzt hatte, so war er sich in dem<br />
Zeitraum, wo er seinen Kommentar zu den Sentenzen abfaßte, doch nicht sicher, in welcher Form<br />
137 I Sent., d. 2, a. unic., q. 1, concl. ad 4 (I, 52 b): “... quod producere aliquem est tripliciter: vel de se ipso,<br />
vel de aliquo creato, vel de nihilo. De se ipso potest Deus producere summum simpliciter, sed ille non erit alius<br />
in natura propter naturae simplicitatem. De alio vel de nihilo non potest producere summum simpliciter, sed in<br />
genere, non propter defectum potentiae agentis, sed propter defectum creaturae, quam neccese est esse<br />
limitatam; et ita non potest producere alium Deum”.<br />
61