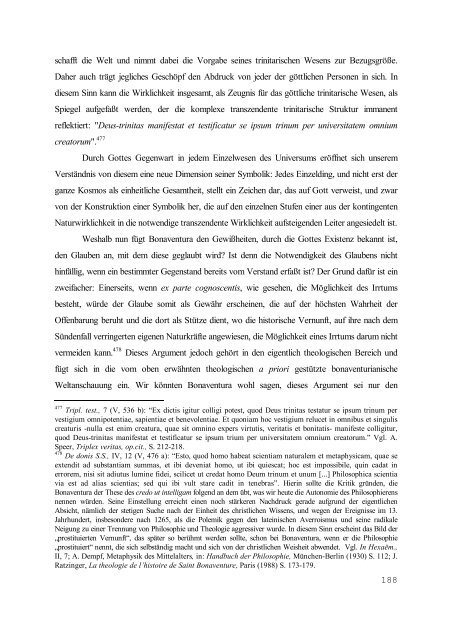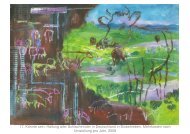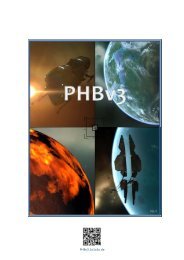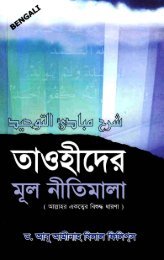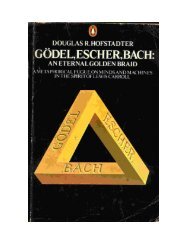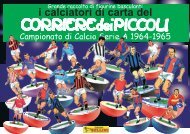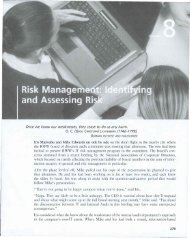1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schafft die Welt und nimmt dabei die Vorgabe seines trinitarischen Wesens zur Bezugsgröße.<br />
Daher auch trägt jegliches Geschöpf den Abdruck von jeder der göttlichen Personen in sich. In<br />
diesem Sinn kann die Wirklichkeit insgesamt, <strong>als</strong> Zeugnis für das göttliche trinitarische Wesen, <strong>als</strong><br />
Spiegel aufgefaßt werden, der die komplexe transzendente trinitarische Struktur immanent<br />
reflektiert: "Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trinum per universitatem omnium<br />
creatorum". 477<br />
Durch Gottes Gegenwart in jedem Einzelwesen <strong>des</strong> Universums eröffnet sich unserem<br />
Verständnis von diesem eine neue Dimension seiner Symbolik: Je<strong>des</strong> Einzelding, und nicht erst der<br />
ganze Kosmos <strong>als</strong> einheitliche Gesamtheit, stellt ein Zeichen dar, das auf Gott verweist, und zwar<br />
von der Konstruktion einer Symbolik her, die auf den einzelnen Stufen einer aus der kontingenten<br />
Naturwirklichkeit in die notwendige transzendente Wirklichkeit aufsteigenden Leiter angesiedelt ist.<br />
Weshalb nun fügt Bonaventura den Gewißheiten, durch die Gottes Existenz bekannt ist,<br />
den Glauben an, mit dem diese geglaubt wird? Ist denn die Notwendigkeit <strong>des</strong> Glaubens nicht<br />
hinfällig, wenn ein bestimmter Gegenstand bereits vom Verstand erfaßt ist? Der Grund dafür ist ein<br />
zweifacher: Einerseits, wenn ex parte cognoscentis, wie gesehen, die Möglichkeit <strong>des</strong> Irrtums<br />
besteht, würde der Glaube somit <strong>als</strong> Gewähr erscheinen, die auf der höchsten Wahrheit der<br />
Offenbarung beruht und die dort <strong>als</strong> Stütze dient, wo die historische Vernunft, auf ihre nach dem<br />
Sündenfall verringerten eigenen Naturkräfte angewiesen, die Möglichkeit eines Irrtums darum nicht<br />
vermeiden kann. 478 <strong>Die</strong>ses Argument jedoch gehört in den eigentlich <strong>theologische</strong>n Bereich und<br />
fügt sich in die vom oben erwähnten <strong>theologische</strong>n a priori gestützte bonaventurianische<br />
Weltanschauung ein. Wir könnten Bonaventura wohl sagen, dieses Argument sei nur den<br />
477 Tripl. test., 7 (V, 536 b): “Ex dictis igitur colligi potest, quod Deus trinitas testatur se ipsum trinum per<br />
vestigium omnipotentiae, sapientiae et benevolentiae. Et quoniam hoc vestigium relucet in omnibus et singulis<br />
creaturis -nulla est enim creatura, quae sit omnino expers virtutis, veritatis et bonitatis- manifeste colligitur,<br />
quod Deus-trinitas manifestat et testificatur se ipsum trium per universitatem omnium creatorum.” Vgl. A.<br />
Speer, Triplex veritas, op.cit., S. 212-218.<br />
478 De donis S.S., IV, 12 (V, 476 a): “Esto, quod homo habeat scientiam naturalem et metaphysicam, quae se<br />
extendit ad substantiam summas, et ibi deveniat homo, ut ibi quiescat; hoc est impossibile, quin cadat in<br />
errorem, nisi sit adiutus lumine fidei, scilicet ut credat homo Deum trinum et unum [...] Philosophica scientia<br />
via est ad alias scientias; sed qui ibi vult stare cadit in tenebras”. Hierin sollte die Kritik gründen, die<br />
Bonaventura der These <strong>des</strong> credo ut intelligam folgend an dem übt, was wir heute die Autonomie <strong>des</strong> Philosophierens<br />
nennen würden. Seine Einstellung erreicht einen noch stärkeren Nachdruck gerade aufgrund der eigentlichen<br />
Absicht, nämlich der stetigen Suche nach der Einheit <strong>des</strong> christlichen Wissens, und wegen der Ereignisse im 13.<br />
Jahrhundert, insbesondere nach 1265, <strong>als</strong> die Polemik gegen den lateinischen Averroismus und seine radikale<br />
Neigung zu einer Trennung von Philosophie und Theologie aggressiver wurde. In diesem Sinn erscheint das Bild der<br />
„prostituierten Vernunft“, das später so berühmt werden sollte, schon bei Bonaventura, wenn er die Philosophie<br />
„prostituiert“ nennt, die sich selbständig macht und sich von der christlichen Weisheit abwendet. Vgl. In Hexaëm.,<br />
II, 7; A. Dempf, Metaphysik <strong>des</strong> Mittelalters, in: Handbuch der Philosophie, München-Berlin (1930) S. 112; J.<br />
Ratzinger, La theologie de l’histoire de Saint Bonaventure, Paris (1988) S. 173-179.<br />
188