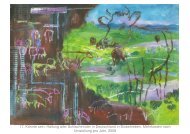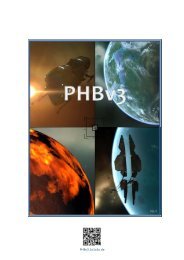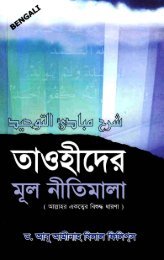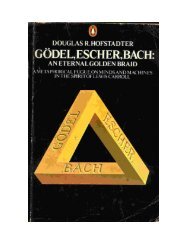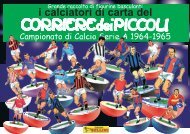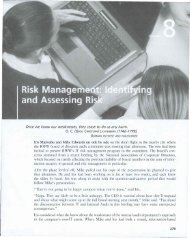1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der Topica ins Spiel, mit dem Bonaventura nunmehr einen Dialog führt. 434 Eine Erkenntnis ist<br />
wahr, wenn wir es mit einer Gewißheit im Gedankengang zu tun haben, d.h. wenn die<br />
Schlußfolgerung sich mit Notwendigkeit aus den Prämissen ergibt. Nun wissen wir auch, daß die<br />
Beziehung zwischen Prämissen und Schlußfolgerung, die der Verstand <strong>als</strong> notwendige Beziehung<br />
erachtet, für Bonaventura nie aus der Existenz der kontingenten Seienden hervorgehen kann,<br />
ebensowenig aus der Existenz der Dinge im Geist; denn wenn sie nicht wirklich existierten, hätten<br />
wir es nur mit fiktiven Wesen zu tun. Bonaventura stößt hier an die Grenze <strong>des</strong> aristotelischen<br />
Ansatzes und schreitet zum exemplaristischen System fort, wenn er darauf schließt, daß unsere<br />
Gewißheit im Erkennen -und mit ihr <strong>des</strong>sen Wahrheit- unleugbar an die Exemplarität der ewigen<br />
Vorgaben gebunden ist. <strong>Die</strong> zum Sein gehörigen Bestimmungen nämlich ließen sich allein aus der<br />
Kenntnis <strong>des</strong> absoluten <strong>Seins</strong> begreifen. 435<br />
Der Ursprung der Erkenntnis wird somit in zweifacher Richtung dargestellt: Auf der einen<br />
Seite stehen die Spezies, die wir aus der von den einzelnen Sinnen geleisteten Vorgabe bilden; und<br />
auf der anderen die angeborenen Kenntnisse, sobald der Verstand seine Spezies ohne Rückgriff auf<br />
die Sinne bilden kann, durch einfache Reflexion über die natürlichen Fähigkeiten, wie im Fall <strong>des</strong><br />
Erkennens der Seelenkräfte und der Gotteserkenntnis. 436 Wenn Aristoteles <strong>als</strong>o sagt, es gebe nichts<br />
im Verstand, was nicht vorher schon in den Sinnen ist, und jede Erkenntnis komme durch die Sinne<br />
zustande, dann dürfte dies nur bei den Dingen gelten, die durch abstrahierte Ähnlichkeit in der Seele<br />
daseien, die nach Art der Schrift in ihr vorkommen. 437<br />
434 Itin., III, 3 (V, 304 a): “Operatio autem virtutis intellectivae est in perceptione intellectus terminorum,<br />
propositionum et illationum. Capit autem intellectus terminorum significata, cum comprehendit, quid est<br />
unumquodque per definitionem. Sed definitio habet fieri per superiora, et illa per superiora definire habent,<br />
usquequo veniatur ad suprema et generalissima, quibus ignoratis, non possunt intelligi definitive inferiora”.<br />
Vgl. Aristoteles, Topic., VI, 3.<br />
435 Itin., III, 3 (V, 304 a): “...non venit intellectus noster ut plene resolvens intellectum alicuius entium<br />
creatorum, nisi invetur ab intellectu entis porissimi, actualissimi, competissimi et absoluti; quod est ens<br />
simpliciter et aeternum, in quo sunt rationes omnium in sua puritate. Quomodo autem sciret intellectus, hoc<br />
esse ens defectivum et incompletum, si nullam haberet cognitionem entis absque omni defectu?”. Vgl. In<br />
Hexaem., V, 28-29 (V, 358 b – 359 a): “...ipse intellectus, considerans conditiones entis secundum relationes<br />
causae ad causatum, trasnfert se ab effectu ad causas et transit ad rationes aeternas [...] triplicer: ratiocinando,<br />
experiendo, intelligendo [...] Per viam rationis sic. Si est ens productum: ergo est ens primum, quia effectus<br />
ponit causam. Si enim est ens ab alio, secundum aliud et propter aliud: ergo est ens a se, secundum se et<br />
propter se. Item, si est ens compositum, necesse est, esse simplex, a quo habet esse, quia esse, quod recedit a<br />
simplicitate, cadit in compositionem. Item, si est ens permixtum, necesse est, esse ens purum, creatum autem<br />
nullum purum”. Vgl. De scient. Christ., q. 4 (V, 26 a): “...utrum quidquid a nobis certitudinaliter cognoscitur<br />
cognoscatur in ipsis rationibus aeternis”.<br />
436 I Sent., d. 17, p. 1, a. unic., q. 4, concl. (I, 301 b) : “Est enim certium [Deum esse] ipsi comprehendenti,<br />
quia cognitio huius veri innata est menti rationali, inquantum tenet rationem imaginis, ratione cuius insertus<br />
est sibi naturalis appetitus et notitia et memoria illius ad cuius imaginem facta est, in quem naturaliter<br />
tendit...”; De myster. Trinit., q. 1, a. 1, concl.<br />
437 II Sent., d. 39, a. 1, q. 2, concl.<br />
169