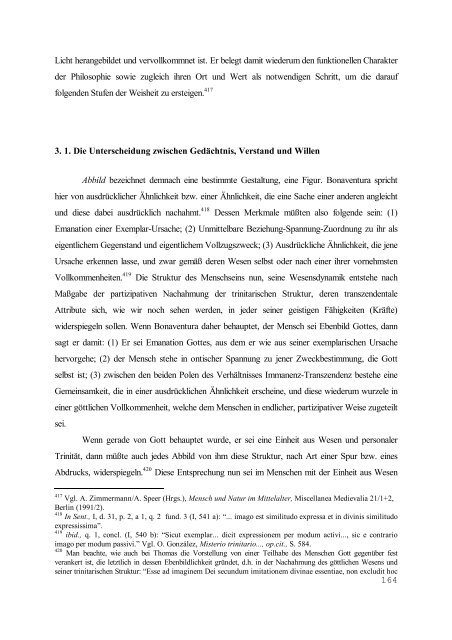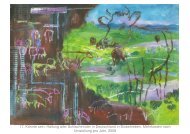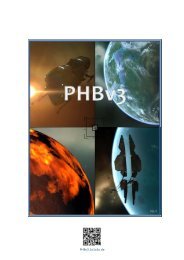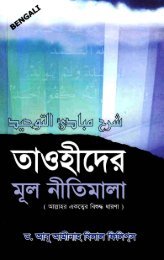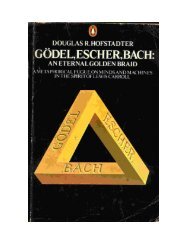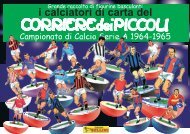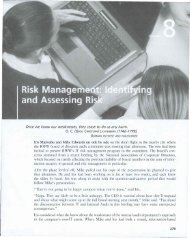1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
1 Die Transzendentalien des Seins als onto-theologische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Licht herangebildet und vervollkommnet ist. Er belegt damit wiederum den funktionellen Charakter<br />
der Philosophie sowie zugleich ihren Ort und Wert <strong>als</strong> notwendigen Schritt, um die darauf<br />
folgenden Stufen der Weisheit zu ersteigen. 417<br />
3. 1. <strong>Die</strong> Unterscheidung zwischen Gedächtnis, Verstand und Willen<br />
Abbild bezeichnet demnach eine bestimmte Gestaltung, eine Figur. Bonaventura spricht<br />
hier von ausdrücklicher Ähnlichkeit bzw. einer Ähnlichkeit, die eine Sache einer anderen angleicht<br />
und diese dabei ausdrücklich nachahmt. 418 Dessen Merkmale müßten <strong>als</strong>o folgende sein: (1)<br />
Emanation einer Exemplar-Ursache; (2) Unmittelbare Beziehung-Spannung-Zuordnung zu ihr <strong>als</strong><br />
eigentlichem Gegenstand und eigentlichem Vollzugszweck; (3) Ausdrückliche Ähnlichkeit, die jene<br />
Ursache erkennen lasse, und zwar gemäß deren Wesen selbst oder nach einer ihrer vornehmsten<br />
Vollkommenheiten. 419 <strong>Die</strong> Struktur <strong>des</strong> Menschseins nun, seine Wesensdynamik entstehe nach<br />
Maßgabe der partizipativen Nachahmung der trinitarischen Struktur, deren transzendentale<br />
Attribute sich, wie wir noch sehen werden, in jeder seiner geistigen Fähigkeiten (Kräfte)<br />
widerspiegeln sollen. Wenn Bonaventura daher behauptet, der Mensch sei Ebenbild Gottes, dann<br />
sagt er damit: (1) Er sei Emanation Gottes, aus dem er wie aus seiner exemplarischen Ursache<br />
hervorgehe; (2) der Mensch stehe in ontischer Spannung zu jener Zweckbestimmung, die Gott<br />
selbst ist; (3) zwischen den beiden Polen <strong>des</strong> Verhältnisses Immanenz-Transzendenz bestehe eine<br />
Gemeinsamkeit, die in einer ausdrücklichen Ähnlichkeit erscheine, und diese wiederum wurzele in<br />
einer göttlichen Vollkommenheit, welche dem Menschen in endlicher, partizipativer Weise zugeteilt<br />
sei.<br />
Wenn gerade von Gott behauptet wurde, er sei eine Einheit aus Wesen und personaler<br />
Trinität, dann müßte auch je<strong>des</strong> Abbild von ihm diese Struktur, nach Art einer Spur bzw. eines<br />
Abdrucks, widerspiegeln. 420 <strong>Die</strong>se Entsprechung nun sei im Menschen mit der Einheit aus Wesen<br />
417 Vgl. A. Zimmermann/A. Speer (Hrgs.), Mensch und Natur im Mittelalter, Miscellanea Medievalia 21/1+2,<br />
Berlin (1991/2).<br />
418 In Sent., I, d. 31, p. 2, a 1, q. 2 fund. 3 (I, 541 a): “... imago est similitudo expressa et in divinis similitudo<br />
expressissima”.<br />
419 ibid., q. 1, concl. (I, 540 b): “Sicut exemplar... dicit expressionem per modum activi..., sic e contrario<br />
imago per modum passivi.” Vgl. O. González, Misterio trinitario..., op.cit., S. 584.<br />
420 Man beachte, wie auch bei Thomas die Vorstellung von einer Teilhabe <strong>des</strong> Menschen Gott gegenüber fest<br />
verankert ist, die letztlich in <strong>des</strong>sen Ebenbildlichkeit gründet, d.h. in der Nachahmung <strong>des</strong> göttlichen Wesens und<br />
seiner trinitarischen Struktur: “Esse ad imaginem Dei secundum imitationem divinae essentiae, non excludit hoc<br />
164