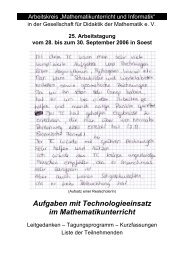WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
T<strong>im</strong>o Leuders<br />
wöhnlich solche, die sich auf elektronische<br />
Medien stützen. Die Virtualität manifestiert<br />
sich darin, dass die Objekte dieser (Teil)Welt<br />
die besonderen Eigenheiten des digitalen<br />
Mediums tragen, wie etwa die Projektion eines<br />
digitalen Quaders auf einen Computerbildschirm<br />
oder die eines vielfach verlinkten<br />
Hypertextes. Mit einer solchen Lernumgebung<br />
<strong>im</strong> engeren Sinne ist also meist der<br />
auf elektronische Medien gestützte Teil<br />
der gesamten Lernumgebung gemeint. Insgesamt<br />
ergibt sich also das in Abb. 2 dargestellte<br />
Bild vom Lernumgebungsbegriff. Dabei<br />
möchte ich ausdrücklich davor warnen,<br />
bei einem <strong>Lernen</strong> mit virtuellen Umgebungen<br />
von "virtuellem <strong>Lernen</strong>" zu sprechen. <strong>Lernen</strong><br />
ist nämlich nie virtuell, sondern findet, ob mit<br />
oder ohne Computer, <strong>im</strong>mer nur real statt.<br />
Mit dem Attribut "virtuell" wird eher auf ein<br />
spezifisches Defizit verwiesen, nämlich auf<br />
das physische Fehlen realer Ansprechpartner<br />
(Mitlerner oder Tutoren) oder haptisch<br />
manipulierbarer Objekte.<br />
In Mode kam der Begriff der Lernumgebung<br />
vor allem seit den frühen neunziger Jahren<br />
<strong>im</strong> Bereich mediengestützten <strong>Lernen</strong>s. Dort<br />
entsponn sich eine Auseinandersetzung zwischen<br />
verschiedenen Schulen (vgl. Schulmeister<br />
2002, 166ff, Kerres 2001, 55ff). Im<br />
Gegensatz zu bis dahin dominierenden so<br />
genannten instruktionistischen Ansätzen<br />
entwickelte sich in der Mediendidaktik eine<br />
Strömung, die die Rolle der Lerneraktivität<br />
betonte. Zuvor hatte man die lerntheoretisch<br />
extrem s<strong>im</strong>plifizierende Philosophie der programmierten<br />
Unterweisung überw<strong>und</strong>en <strong>und</strong><br />
sich zu differenzierteren kognitivistischen<br />
Ansätzen weiterentwickelt, die sich in so genannten<br />
intelligenten tutoriellen Systemen<br />
(ITS) manifestierten. Gr<strong>und</strong>prinzip solcher<br />
Lehrsysteme war aber <strong>im</strong>mer noch die Auffassung,<br />
ein computergestütztes System<br />
könne durch Diagnose des <strong>Lernen</strong>den ein<br />
hinreichend mächtiges Lernermodell entwickeln<br />
<strong>und</strong> auf dieser Gr<strong>und</strong>lage effiziente Instruktionsprozesse<br />
organisieren.<br />
Im Rahmen einer hier entstehenden Neuorientierung<br />
in der Entwicklung <strong>und</strong> Erforschung<br />
mediengestützten <strong>Lernen</strong>s gewann<br />
der Begriff der Lernumgebung eine wesentliche<br />
Bedeutungsd<strong>im</strong>ension: In dem Maße, in<br />
dem die Aktivitäten des <strong>Lernen</strong>den in den<br />
Vordergr<strong>und</strong> gestellt werden, wird ein computergestütztes<br />
Lernsystem zu einer Lernumgebung,<br />
in der sich der <strong>Lernen</strong>de nach<br />
seinen Bedürfnissen bewegt <strong>und</strong> in der er<br />
seinen Lernprozess selbst kontrolliert <strong>und</strong><br />
nicht durch das System kontrolliert wird.<br />
10<br />
Eine erkenntnis- wie lerntheoretische Verankerung<br />
findet diese Auffassung vom <strong>Lernen</strong>,<br />
die sich nicht allein auf das mediengestützte<br />
<strong>Lernen</strong> bezieht, <strong>im</strong> (pädagogischen) Konstruktivismus,<br />
dessen breite Diskussion <strong>im</strong><br />
allgemeinen pädagogischen Feld ungefähr<br />
zur selben Zeit einsetzte (Gerstenmeier &<br />
Mandl 1995). Seit dieser Zeit berufen sich<br />
viele theoretische Modelle <strong>und</strong> praktische<br />
Umsetzungen auf eine konstruktivistische<br />
Position, <strong>und</strong> auch die hierbei entworfenen<br />
Lernumgebungen werden als konstruktivistisch<br />
bezeichnet, <strong>—</strong> mit durchaus unterschiedlicher<br />
Berechtigung, wie das folgende<br />
Beispiel zeigt:<br />
Zwar ist die Software "Kreuzritter"<br />
nicht netzwerkfähig, jedoch spricht<br />
nichts gegen die Lösung der Rätsel in<br />
Gruppenarbeit vor dem Monitor, das<br />
dem Anspruch nach <strong>Lernen</strong> in einem<br />
sozialen Kontext gerecht wird. (Aus einer<br />
Rezension der S<strong>im</strong>ulationssoftware<br />
"Kreuzritter" www.lpm.uni-sb.de/<br />
neuemedien/analyze/kreuzz.html)<br />
Was also macht eine konstruktivistische<br />
Lernumgebung aus? Gibt es hierfür eindeutige<br />
Kriterien? Zu keiner Zeit hat es so etwas<br />
wie eine geschlossene, konstruktivistische<br />
Position oder Theorie gegeben, <strong>—</strong> weder in<br />
der Mediendidaktik noch in der Pädagogik.<br />
Vielmehr gibt es Hauptströmungen konstruktivistischen<br />
"Gedankengutes" (ich wähle hier<br />
bewusst nicht den Terminus "Theorie"), die<br />
unterschiedlichen Quellen entspringen <strong>und</strong><br />
sich gegenseitig beeinflussen. Auch der vorliegende<br />
Text schöpft aus dieser Orientierungsvielfalt<br />
<strong>und</strong> bezieht sich je nach Argumentationszusammenhang<br />
auf:<br />
• eine radikal-konstruktivistische Anthropologie,<br />
die sich an vielen Stellen durch aktuelle<br />
neurobiologische Erkenntnisse unterstützt<br />
sieht. Diese Sichtweise liegt vor<br />
allem Abschnitt (1) ("konstruktivistisches<br />
Menschenbild") zugr<strong>und</strong>e.<br />
• eine "gemäßigt" oder "pragmatisch" genannte<br />
konstruktivistische Position, bei<br />
der konstruktivistische Aspekte hinsichtlich<br />
der Analyse <strong>und</strong> Synthese von Lernarrangements<br />
berücksichtigt werden.<br />
Hierzu gehören vor allem Ansätze, die Instruktions-<br />
<strong>und</strong> Konstruktionsaspekte zu<br />
Formen des so genannten instructional<br />
design verbinden <strong>und</strong> dabei Kriterien für<br />
Lernumgebungen herausarbeiten, wie sie<br />
auch in Abschnitt (3) ("konstruktivistische<br />
Lernumgebungen") aufgenommen werden<br />
sollen. Solche Kriterien sind Gegenstand<br />
empirisch-psychologischer Untersuchungen<br />
(Gerstenmeier & Mandl 1995).