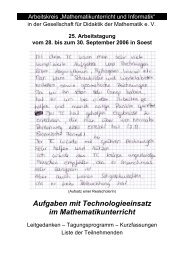WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
T<strong>im</strong>o Leuders<br />
Hypermedia-Systeme vor, wie sie Seeberg<br />
(2002, 10ff) vorstellt. Hier können z.B. alle<br />
Links offen stehen, aber mit Hilfe einer Ampelmetapher<br />
dem Lerner deutlich gemacht<br />
werden, in wie weit er aufgr<strong>und</strong> seines Lernmodells<br />
<strong>und</strong> Lernweges die Voraussetzungen<br />
für die Bearbeitung des dahinter liegenden<br />
Moduls erfüllt.<br />
Ein weiteres Kriterium für eine offenere, lernerzentrierte<br />
Auffassung von Interaktivität einer<br />
Lernumgebung liefert Schulmeister<br />
(2002). Diese kann dem <strong>Lernen</strong>den erlauben,<br />
aktiv in ihre Struktur einzugreifen <strong>und</strong><br />
sie nach seinen Wünschen umzugestalten.<br />
Für diese Art von reziproker Adaptivität sind<br />
gerade Hypermedia-Systeme gut geeignet:<br />
Der <strong>Lernen</strong>de kann den Elementen eigene<br />
Annotationen hinzufügen, kann ggf. auch Ergänzungen<br />
<strong>und</strong> Änderungen von Inhalten<br />
oder strukturellen Verknüpfungen vornehmen.<br />
Einige zusammenfassende<br />
Bemerkungen<br />
Die folgenden Bemerkungen zu einigen<br />
Kernfragen des <strong>Lernen</strong>s in medialen, konstruktivistischen<br />
Lernumgebungen sind zwar<br />
als Konsequenz der vorangehenden Ausführung<br />
zu verstehen, sind aber weniger systematisch<br />
<strong>und</strong> eher subjektiv geprägt.<br />
Welche Rolle spielt das konstruktivistische<br />
Paradigma für das <strong>Lernen</strong>?<br />
Es ist deutlich geworden, dass viele der hier<br />
zusammengetragenen Anforderungen an<br />
Lernumgebungen nicht unbedingt eines konstruktivistischen<br />
Hintergr<strong>und</strong>es bedürfen. Die<br />
konstruktivistische Position, die vor allem Situiertheit<br />
<strong>und</strong> Selbstregulation betont, erweist<br />
sich als wichtiges Korrektiv: Dass <strong>und</strong> warum<br />
gerade computergestützte Lernarrangements<br />
<strong>im</strong>mer noch besondere Gefahr laufen, einen<br />
einseitig vermittlungsorientierten Ansatz zu<br />
verfolgen, ist aus den vorangehenden Argumenten<br />
<strong>und</strong> Beispielen deutlich geworden.<br />
Welche Hoffnungen sind mit computergestützten<br />
Lernumgebungen verb<strong>und</strong>en?<br />
Die Gründe, die für eine stärkere Förderung<br />
eines computer- <strong>und</strong> internetgestützten <strong>Lernen</strong>s<br />
angeführt werden, klingen meist plausibel,<br />
müssen sich aber auf ihren Gehalt kritisch<br />
hinterfragen lassen. Um nur einige wesentliche<br />
Beispiele zu nennen:<br />
30<br />
• Innovation der Lehrformen: Allein die Diagnose<br />
mangelnder Qualität herkömmlichen<br />
Unterrichts ist nicht hinreichend dafür,<br />
Hoffnungen in Computersysteme zu<br />
setzen. Vielen erkennbaren Vorteilen<br />
(emotionale Neutralität, individuelle Lerntempi)<br />
können ebenso gewichtige Nachteile<br />
entgegengesetzt werden (mangelnde<br />
Kommunikation, keine Verstehensprozesse<br />
seitens des Systems). Ausgesprochene<br />
Kritiker formulieren ihre Thesen hierzu<br />
sogar noch krasser: "Alles, was man pädagogisch<br />
erreichen/vermeiden will, erreicht/vermeidet<br />
man besser ohne den<br />
Computer. Alle Dummheiten, die die<br />
Schule macht, macht sie mit ihm verstärkt.<br />
Das, was man nur an <strong>und</strong> mit dem<br />
Computer lernen kann, ist herzlich wenig<br />
<strong>und</strong> kann kurz vor der Entlassung in die<br />
Arbeitswelt realistischer <strong>und</strong> wirksamer<br />
absolviert werden" (von Hentig 1993).<br />
• Öffnung von Schule. In wie weit ist die<br />
Öffnung der Grenzen über die Lerngruppe<br />
hinaus wesentliche Qualitätssteigerung?<br />
In wie weit kann das Informationsangebot<br />
<strong>und</strong> die Möglichkeit der weltweiten Kommunikation<br />
wirksam in den Unterricht integriert<br />
werden?<br />
• Aktualität. Wie aktuell müssen Informationen<br />
für den <strong>Mathematik</strong>unterricht wirklich<br />
sein? Hier ist die Bedeutung des Aktualitätskriteriums<br />
für den Politikunterricht sicherlich<br />
unmittelbarer (obwohl es auch<br />
hier Alternativmedien gibt!).<br />
• Kommunikation. Eine Kommunikationssteigerung<br />
ist wohl allein dort zu verzeichnen,<br />
wo <strong>Lernen</strong>de ansonsten notwendig<br />
physisch getrennt agieren müssten<br />
(Flächenbesiedlung, Spezialkurse,<br />
Zweiter Bildungsweg).<br />
• Medienkompetenz für lebenslanges <strong>Lernen</strong>,<br />
als Teil von Allgemeinbildung, als<br />
notwendige Bedingung für den ökonomischen<br />
Status der Gesellschaft ("Standortfrage").<br />
Hier treffen wir wirtschafts- <strong>und</strong><br />
bildungspolitische Argumente, die meist<br />
eher ideologisch als sachlich verwendet<br />
werden. Ob jeder Arbeitnehmer künftig<br />
he<strong>im</strong>ischer Selbstlerner sein muss, um<br />
mit betrieblichen Entwicklungen mitzuhalten,<br />
wie viel Medienkompetenz in der<br />
Schule erworben werden muss ("<strong>Internet</strong>führerschein"),<br />
ist mehr von normativen<br />
Zielvorstellungen als von nüchternen Analysen<br />
best<strong>im</strong>mt. Zum Auftrag der Pädagogik<br />
gehört allerdings auch, junge Menschen<br />
darin zu unterstützen, dass sie "der<br />
technischen Zivilisation gewachsen bleiben"<br />
<strong>—</strong> so Hartmut von Hentig (2002).