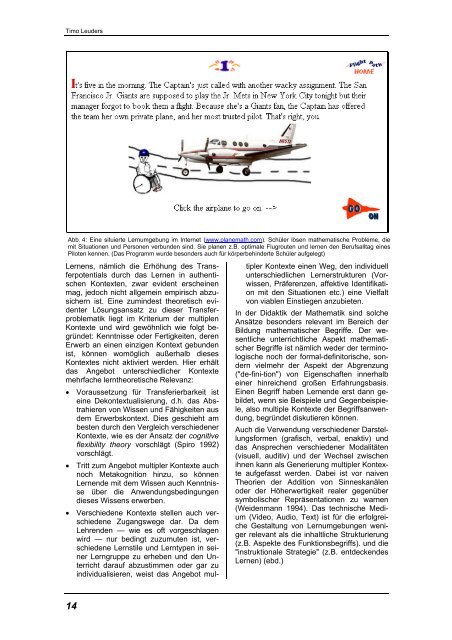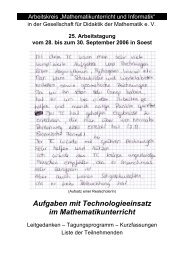WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
T<strong>im</strong>o Leuders<br />
Abb. 4: Eine situierte Lernumgebung <strong>im</strong> <strong>Internet</strong> (www.planemath.com). Schüler lösen mathematische Probleme, die<br />
mit Situationen <strong>und</strong> Personen verb<strong>und</strong>en sind. Sie planen z.B. opt<strong>im</strong>ale Flugrouten <strong>und</strong> lernen den Berufsalltag eines<br />
Piloten kennen. (Das Programm wurde besonders auch für körperbehinderte Schüler aufgelegt)<br />
<strong>Lernen</strong>s, nämlich die Erhöhung des Transferpotentials<br />
durch das <strong>Lernen</strong> in authentischen<br />
Kontexten, zwar evident erscheinen<br />
mag, jedoch nicht allgemein empirisch abzusichern<br />
ist. Eine zumindest theoretisch evidenter<br />
Lösungsansatz zu dieser Transferproblematik<br />
liegt <strong>im</strong> Kriterium der multiplen<br />
Kontexte <strong>und</strong> wird gewöhnlich wie folgt begründet:<br />
Kenntnisse oder Fertigkeiten, deren<br />
Erwerb an einen einzigen Kontext geb<strong>und</strong>en<br />
ist, können womöglich außerhalb dieses<br />
Kontextes nicht aktiviert werden. Hier erhält<br />
das Angebot unterschiedlicher Kontexte<br />
mehrfache lerntheoretische Relevanz:<br />
• Voraussetzung für Transferierbarkeit ist<br />
eine Dekontextualisierung, d.h. das Abstrahieren<br />
von Wissen <strong>und</strong> Fähigkeiten aus<br />
dem Erwerbskontext. Dies geschieht am<br />
besten durch den Vergleich verschiedener<br />
Kontexte, wie es der Ansatz der cognitive<br />
flexibility theory vorschlägt (Spiro 1992)<br />
vorschlägt.<br />
• Tritt zum Angebot multipler Kontexte auch<br />
noch Metakognition hinzu, so können<br />
<strong>Lernen</strong>de mit dem Wissen auch Kenntnisse<br />
über die Anwendungsbedingungen<br />
dieses Wissens erwerben.<br />
• Verschiedene Kontexte stellen auch verschiedene<br />
Zugangswege dar. Da dem<br />
<strong>Lehren</strong>den <strong>—</strong> wie es oft vorgeschlagen<br />
wird <strong>—</strong> nur bedingt zuzumuten ist, verschiedene<br />
Lernstile <strong>und</strong> Lerntypen in seiner<br />
Lerngruppe zu erheben <strong>und</strong> den Unterricht<br />
darauf abzust<strong>im</strong>men oder gar zu<br />
individualisieren, weist das Angebot mul-<br />
14<br />
tipler Kontexte einen Weg, den individuell<br />
unterschiedlichen Lernerstrukturen (Vorwissen,<br />
Präferenzen, affektive Identifikation<br />
mit den Situationen etc.) eine Vielfalt<br />
von viablen Einstiegen anzubieten.<br />
In der Didaktik der <strong>Mathematik</strong> sind solche<br />
Ansätze besonders relevant <strong>im</strong> Bereich der<br />
Bildung mathematischer Begriffe. Der wesentliche<br />
unterrichtliche Aspekt mathematischer<br />
Begriffe ist nämlich weder der terminologische<br />
noch der formal-definitorische, sondern<br />
vielmehr der Aspekt der Abgrenzung<br />
("de-fini-tion") von Eigenschaften innerhalb<br />
einer hinreichend großen Erfahrungsbasis.<br />
Einen Begriff haben <strong>Lernen</strong>de erst dann gebildet,<br />
wenn sie Beispiele <strong>und</strong> Gegenbeispiele,<br />
also multiple Kontexte der Begriffsanwendung,<br />
begründet diskutieren können.<br />
Auch die Verwendung verschiedener Darstellungsformen<br />
(grafisch, verbal, enaktiv) <strong>und</strong><br />
das Ansprechen verschiedener Modalitäten<br />
(visuell, auditiv) <strong>und</strong> der Wechsel zwischen<br />
ihnen kann als Generierung multipler Kontexte<br />
aufgefasst werden. Dabei ist vor naiven<br />
Theorien der Addition von Sinneskanälen<br />
oder der Höherwertigkeit realer gegenüber<br />
symbolischer Repräsentationen zu warnen<br />
(Weidenmann 1994). Das technische Medium<br />
(Video, Audio, Text) ist für die erfolgreiche<br />
Gestaltung von Lernumgebungen weniger<br />
relevant als die inhaltliche Strukturierung<br />
(z.B. Aspekte des Funktionsbegriffs). <strong>und</strong> die<br />
"instruktionale Strategie" (z.B. entdeckendes<br />
<strong>Lernen</strong>) (ebd.)