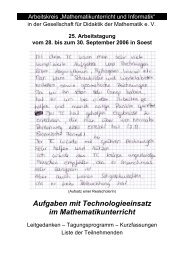WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bert Xylander<br />
darstellung eine anschauliche Inhaltsorganisation<br />
eingefordert wird. Realisiert wird dieses<br />
Prinzip hauptsächlich durch die Kombination<br />
inhaltlicher Textdarstellung mit darstellungsorientierten<br />
Veranschaulichungen (z.B.<br />
in Form virtuell-dreid<strong>im</strong>ensionaler Modelle<br />
oder dynamischer Medien-Korrelationen).<br />
4.6 Aktivitätsförderung<br />
Ebenfalls als inhaltsorientiertes, aber auch<br />
medial orientiertes Prinzip wirkt das Prinzip<br />
der Aktivitätsförderung. Dieses Prinzip beschreibt<br />
die Gestaltung der Lehreinheiten als<br />
eine ausgewogene Mischung textueller Inhaltsdarstellung<br />
mit interaktiven mult<strong>im</strong>edialen<br />
Elementen, die sich wechselseitig sinnunterstützend<br />
durchdringen. Didaktischer Hintergr<strong>und</strong><br />
ist die Mischung instruktiver Texte<br />
mit aktivitätsfördernden Elementen, um verschiedene<br />
Lerntypen anzusprechen. Als<br />
zweiter Aspekt des Prinzips der Aktivitätsförderung<br />
soll das Handeln der Studierenden<br />
betont werden. Nur durch ein selbst best<strong>im</strong>mtes,<br />
aktives Erarbeiten sind die Studierenden<br />
in der Lage, sich die <strong>—</strong> vielfach abstrakten<br />
<strong>—</strong> Inhalte eigenständig anzueignen.<br />
Bedeutung kommt hierbei auch dem motivationalen<br />
Aspekt der Auseinandersetzung mit<br />
den Lehrinhalten bei: Aktivitätsfördernde<br />
(mult<strong>im</strong>ediale) Komponenten sind in der Lage,<br />
eine <strong>—</strong> für einen Lernerfolg notwendige<br />
<strong>—</strong> intrinsische Motivationslage extrinsisch<br />
aufzuwerten.<br />
4.7 Aktive Lernkontrolle<br />
Ein wesentlicher Bestandteil jedes mult<strong>im</strong>edialen<br />
Lehrmaterials sind die Formen der<br />
Lernkontrolle. Die Gestaltung der Lernkontrolle<br />
wird durch fünf verschiedene didaktische<br />
Aspekte geprägt: durch die inhaltliche<br />
206<br />
Drehung um 90°<br />
Drehachse<br />
Drehung um 45°<br />
Transparenz<br />
Drehung um 90°<br />
Drehachse<br />
Drehung um 45°<br />
Transparenz<br />
Abb. 2: Drehoperationen an einem virtuell-dreid<strong>im</strong>ensionalen Würfelmodell: Mit Hilfe des miniaturisierten Vergleichmodells<br />
in Ausgangslage (in der linken oberen Ecke) ist leicht nachzuvollziehen, dass eine Drehung um einen Winkel von 90° um<br />
die dargestellte Drehachse eine Symmetrieoperation <strong>—</strong> bzw. Deckabbildung <strong>—</strong> ist (linke Seite; nach der Drehung); die<br />
Drehung um einen Winkel von 45° dagegen nicht (rechte Seite; nach der Drehung).<br />
<strong>und</strong> durch die mediale Organisation der<br />
Lernkontrolle, durch den Aspekt der Aktivitätsförderung,<br />
durch die individuell determinierten<br />
Aspekte der Eigenverantwortlichkeit<br />
<strong>und</strong> der Lernbereitschaft der Studierenden.<br />
Das damit charakterisierte Spannungsfeld<br />
begründet das didaktische Prinzip der aktiven<br />
Lernkontrolle.<br />
Im Lehrmaterial "Symmetrie molekularer<br />
Strukturen" werden fünf Aufgabentypen zur<br />
Lernkontrolle eingesetzt: Wissensaufgaben,<br />
Lernaufgaben, Anwendungsaufgaben, Formalaufgaben<br />
<strong>und</strong> Handlungsaufgaben:<br />
Wissensaufgaben: Nennen Sie 3 Unterschiede<br />
zwischen Drehspiegelachsen Sn mit<br />
geradem n <strong>und</strong> ungeradem n.<br />
Lernaufgaben: Warum ist die S2-Symmetrie<br />
äquivalent zur Inversionssymmetrie?<br />
Anwendungsaufgaben: Kann es eine Symmetrieachse<br />
geben, bei der die Symmetrieoperation<br />
mit dem kleinsten Drehwinkel eine<br />
Drehung um 35° ist?<br />
Formalaufgaben: Beurteilen Sie die folgenden<br />
Aussagen nach ihrer Richtigkeit:<br />
• Die Menge {1, -1} bildet eine Gruppe.<br />
• Die Menge {1, -1} bildet mit der Addition<br />
eine Gruppe.<br />
• Die Menge {1, -1} bildet mit der Multiplikation<br />
eine Gruppe.<br />
Handlungsaufgaben: Ermitteln Sie aus den<br />
Drehsymmetrieoperationen der drei senkrecht<br />
aufeinander stehenden C2-Achsen des<br />
Tetraeders die zugehörige Gruppentafel (s.a.<br />
Abb. 3).<br />
Tab. 1: Beispiele für die fünf Formen der Lernkontrolle<br />
<strong>im</strong> Lehrmaterial "Symmetrie molekularer Strukturen"<br />
Unterscheidungskriterien sind neben dem<br />
Grad der Aktivitätsförderung die didaktische<br />
Intention, die inhaltliche Organisation <strong>und</strong> die<br />
mediale Präsentation der Lernkontrolle.