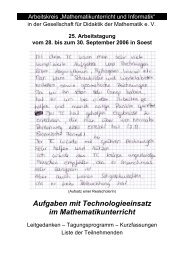WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
T<strong>im</strong>o Leuders<br />
• Formen der synchronen Kommunikation<br />
(Chats, Virtuelle Klassenz<strong>im</strong>mer, Video<strong>und</strong><br />
Audiokonferenzen)<br />
• Plattformen für den Dokumentenaustausch<br />
(shared workspaces)<br />
• Techniken des application sharing (Für<br />
die <strong>Mathematik</strong> bedeutsam: Wie können<br />
zwei entfernte Lernpartner dieselbe CAS-<br />
Oberfläche sehen <strong>und</strong> bearbeiten?)<br />
Unter den Stichworten CSCW (computer<br />
supported cooperative work) <strong>und</strong> CSCL<br />
(computer supported cooperative learning)<br />
gibt es vielfältige konkrete Projekte, besonders<br />
<strong>im</strong> Bereich der Weiterbildung <strong>und</strong> der<br />
universitären Lehre (Wessner 2002). Solche<br />
Systeme können zur direktiven Steuerung<br />
(Beispiel: Der Lehrer stellt einen Lernplan in<br />
die Arbeitsumgebung), zur symmetrischen<br />
Kooperation (Beispiel: arbeitsteilige Projektarbeit),<br />
aber auch zur konkurrierenden Arbeit<br />
(Beispiel: Wettbewerbe) genutzt werden.<br />
Die Chance, die in der CSCL-Technologie<br />
gesehen wird, bezieht sich vor allem auf eine<br />
Erhöhung der Intensität <strong>und</strong> der Qualität von<br />
Interaktivität in computerunterstützten Lernumgebungen.<br />
Aus konstruktivistischer Sicht<br />
spielt hier aber auch der Aspekt von Wissen<br />
als sozialer Konstruktion eine Rolle: Wir<br />
kommunizieren nicht über Wirklichkeit, sondern<br />
erschaffen Wirklichkeit in der Kommunikation<br />
(Watzlawick)<br />
Die Realisierung solcher kommunikativer<br />
Elemente findet oftmals über so genannte<br />
Lernplattformen statt. Dieser Begriff ist nicht<br />
<strong>im</strong>mer klar abgegrenzt. Meist versteht man<br />
hierunter eine Kombination verschiedener Informations-<br />
<strong>und</strong> Kommunikationselemente<br />
(Schulmeister 2001, 165): Einstiegsportal,<br />
Kursmanagement, Darstellung von Kursunterlagen,<br />
Online-Kurse (Seminare), Autorenwerkzeuge<br />
für <strong>Lehren</strong>de, Werkzeuge zum<br />
kooperativen Arbeiten.<br />
Im Bereich des schulischen Einsatzes ist jeweils<br />
sehr gewissenhaft nach dem Mehrwert<br />
solcher Systeme zu prüfen: Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler in allgemeinbildenden Schulen<br />
haben in der Regel viele Möglichkeiten, direkt<br />
miteinander zu kommunizieren <strong>und</strong> zu<br />
kooperieren. (Hierfür wird heutzutage <strong>—</strong> als<br />
sei es bereits die Ausnahmesituation <strong>—</strong> der<br />
schöne Begriff "face to face" verwendet).<br />
Elektronische Kommunikation kann zu einer<br />
Bereicherung führen, wie z.B. in Distanzphasen<br />
in der beruflichen Weiterbildung (vgl. das<br />
NRW-Projekt www.abitur-online.nrw.de für<br />
den zweiten Bildungsweg), oder eben zur<br />
Verarmung durch Surrogatkommunikation:<br />
Muss z.B. die Verteilung von Lernmaterial,<br />
28<br />
die Rücksendung <strong>und</strong> Kommentierung von<br />
Dokumenten auch bei schulischen Hausaufgaben<br />
über eine Lernplattform laufen (vgl.<br />
das Schwesterprojekt www.selgo.de für die<br />
gymnasiale Oberstufe)?<br />
Oft wird auch der Aspekt der "verteilten Kognition"<br />
beschworen. In kooperativen Arbeitsumgebungen<br />
können Mitglieder arbeitsteilig<br />
ihre spezifische "Experten"sichten beitragen.<br />
So entsteht eine gemeinsame Wissensbasis<br />
in der Summe von Einzelbeiträgen.<br />
Verteiltes Wissen kann zu geteiltem<br />
Wissen werden. Systeme für ein solches<br />
Wissensmanagement können z.T. berückend<br />
einfach sein, wie das WIKI-Projekt zeigt<br />
(www.wikipedia. de). Schulen sammeln bereits<br />
erste Erfahrungen, insbesondere <strong>im</strong> Bereich<br />
der Informatik. Letztlich sind die zahlreichen<br />
(kommerziellen) Hausaufgaben- <strong>und</strong><br />
Facharbeitenbörsen auch solche Systeme<br />
verteilten Wissens. Ihre Existenz stellt eine<br />
Herausforderung für das Bild schulisch erworbenen<br />
Wissens dar.<br />
Schließlich soll auch die (vermeintliche?)<br />
globale Öffnung durch elektronische Kommunikation<br />
zur Sprache kommen. Der Sinn<br />
<strong>und</strong> Erfolg von E-Mail Austausch-Projekten<br />
ist <strong>im</strong> sprachlichen Bereich erwartungsgemäß<br />
höher als in der <strong>Mathematik</strong>. Auch der<br />
Austausch mit externen Experten per E-Mail<br />
wird für den <strong>Mathematik</strong>unterricht wohl in<br />
nächster Zeit eher von sek<strong>und</strong>ärer Bedeutung<br />
sein <strong>und</strong> auf Leuchtturmprojekte beschränkt<br />
bleiben.<br />
Mit Schulmeister (2002, 206) kann man abschließend<br />
feststellen: "Ob <strong>und</strong> wie kooperativ<br />
gelernt wird hängt entscheidend davon ab,<br />
wie das technische System in den höheren<br />
Lernzusammenhang eingebettet ist".<br />
(e) Interaktivität in Form von Adaptivität<br />
Alle <strong>Lernen</strong>den sind verschieden. Diese<br />
ebenso lapidare wie unbestreitbare Aussage<br />
muss Konsequenzen für die Gestaltung einer<br />
Lernumgebung haben. Vom menschlichen<br />
<strong>Lehren</strong>den fordern wir eine flexible Anpassung<br />
an die Bedürfnisse der einzelnen <strong>Lernen</strong>den,<br />
angemessene Reaktionen auf deren<br />
individuellen Beiträge <strong>und</strong> das Angebot differenzierter<br />
Lerngelegenheiten <strong>und</strong> Lerntempi.<br />
Doch auch ein Lehrer ist schnell überfordert,<br />
wenn er dies bei dreißig Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern zugleich leisten soll. Konstruktivistische<br />
Ansätze entheben den <strong>Lehren</strong>den von<br />
der früher vehement propagierten, wenngleich<br />
unlösbaren Aufgabe der individuellen<br />
Differenzierung ("Jedem Schüler sein eigenes<br />
Arbeitsblatt"). Eine angemessene Differenzierung<br />
können letztlich allein die <strong>Lernen</strong>-