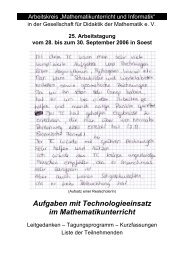WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
• Wie ist ein virtuelles Seminar zu gestalten,<br />
das Studierende verschiedener<br />
Hochschulen zusammenbringt?<br />
• Werden unsere Erwartungen <strong>und</strong> Hoffnungen<br />
<strong>im</strong> Hinblick auf das selbstbest<strong>im</strong>mte<br />
<strong>und</strong> kooperative Arbeiten erfüllt?<br />
• Ist gegenüber einem traditionellen Seminar<br />
ein Mehrwert <strong>im</strong> Hinblick auf die Ziele<br />
(ein Ziel) der Lehrerausbildung festzustellen?<br />
• Welche technischen, inhaltlichen, kommunikativen<br />
Schwierigkeiten treten während<br />
des Seminars auf?<br />
• Welche Qualität hat das zu erzeugende<br />
Produkt (<strong>Internet</strong>seiten)?<br />
Bevor aber spezielle Forschungsfragen gestellt<br />
<strong>und</strong> untersucht werden können, müssen<br />
zuerst Erfahrungen mit der Realität virtueller<br />
Veranstaltungen gemacht werden, sonst besteht<br />
die Gefahr, in den technischen Problemen<br />
stecken zu bleiben.<br />
4 Konzeptionelle Gestaltung<br />
4.1 Personen<br />
Teilnehmer an dem Seminar waren Studierende<br />
für die Lehrämter an Gymnasien, Real-<br />
<strong>und</strong> Hauptschulen. Somit war das Vorwissen<br />
sowohl in fachlicher als auch didaktischer<br />
Hinsicht sehr unterschiedlich. Die Studierenden<br />
für das Lehramt an Gymnasium waren<br />
mehrheitlich <strong>im</strong> 3. Semester <strong>und</strong> hatten bisher<br />
noch keine Didaktikveranstaltung gehört. 1<br />
4.2 Thema<br />
Das Thema des Seminars "Geometrie in der<br />
Umwelt" spricht <strong>Lernen</strong>de an, ist wichtig für<br />
alle Schularten <strong>und</strong> in jede Studienordnung<br />
integrierbar. Die Dozenten wählten sechs<br />
Themenbereiche <strong>im</strong> Hinblick auf gute Bearbeitungsmöglichkeiten<br />
aus: Flächeninhalte,<br />
Dreiecke, Spiegel, Spiralen, Strahlensatz <strong>und</strong><br />
Trigonometrie. Für alle Studierenden war<br />
dieses Seminar eine Pflichtveranstaltung, in<br />
der ein Leistungsnachweis erworben werden<br />
konnte.<br />
1 Das ist sicherlich nicht wünschenswert; aufgr<strong>und</strong> einer Änderung<br />
der Studienordnung musste diesen Studierenden kurzfristig eine<br />
neue Veranstaltung angeboten werden; <strong>und</strong> dabei handelte es<br />
sich um das hier beschriebene Virtuelle Seminar.<br />
Ein virtuelles Seminar <strong>—</strong> Konzeption, Durchführung <strong>und</strong> Auswertung<br />
4.3 Interaktionsformen<br />
Um den durch die Virtualität gegebenen Vorteil<br />
verteilter Standorte mit verschiedenen<br />
personalen Ausgangssituationen (fachliches,<br />
didaktisches Vorwissen sowie Studienschwerpunkt)<br />
bestmöglich zu nutzen (<strong>und</strong> die<br />
Studierenden zur Kooperation mit den anderen<br />
Hochschulen zu zwingen), wurde jedem<br />
Standort ein Bearbeitungsschwerpunkt zugeordnet.<br />
• Würzburg übernahm die fachliche<br />
Aufarbeitung der Inhalte,<br />
• in Ludwigsburg widmete man sich der didaktischen<br />
Aufbereitung der Themenbereiche,<br />
<strong>und</strong><br />
• in Karlsruhe geschah die Umsetzung für<br />
den Unterricht, also die methodische Aufbereitung.<br />
• Weingarten setzte die Themen durch Vermessungsaufgaben<br />
<strong>im</strong> Gelände um, es<br />
handelte sich also um eine praktische<br />
Aufbereitung.<br />
Entsprechend der sechs Themenbereiche<br />
wurden an jeder Hochschule sechs Gruppen<br />
von je 2 – 4 Personen gebildet, die Standortgruppen.<br />
Eine Themengruppe bestand dann<br />
aus den vier Standortgruppen der vier Hochschulen,<br />
somit aus 10 – 16 Personen. Insgesamt<br />
nahmen 83 Personen an dem Seminar<br />
teil.<br />
Die Arbeit an den Standorten war sehr unterschiedlich<br />
organisiert. In Weingarten traf sich<br />
die Gesamtgruppe überwiegend "real", in<br />
Ludwigsburg nur "virtuell" <strong>und</strong> in Karlsruhe<br />
<strong>und</strong> Würzburg in Mischformen. Die Zusammenarbeit<br />
innerhalb der Themengruppe verlief<br />
rein virtuell. Eine weitere Aufteilung der<br />
Zuständigkeiten innerhalb einer Standortgruppe<br />
blieb den Studierenden selbst überlassen.<br />
So bot es sich an, dass sich etwa ein<br />
Student um die technische Aufbereitung, ein<br />
anderer um das Literaturstudium in der Bibliothek<br />
<strong>und</strong> ein dritter um die <strong>Internet</strong>recherche<br />
kümmerte.<br />
Somit entstand eine virtuelle Form eines<br />
"Gruppenpuzzles" (Stebler u.a. 1994, Bett<br />
u.a. 2002), bei dem zunächst von den Standortgruppen<br />
je ein Teil eines Themenbereiches<br />
bearbeitet wurde. In der Mischung von<br />
realen Terminen vor Ort, virtueller Zusammenarbeit<br />
hochschulintern <strong>und</strong> -extern entstand<br />
somit eine "hybride Form" des Lernarrangements.<br />
59