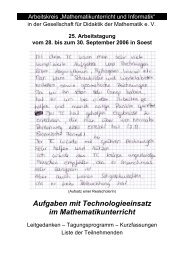WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
WWW und Mathematik — Lehren und Lernen im Internet
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
T<strong>im</strong>o Leuders<br />
Abb. 8: Darstellungsformen: "sprachlich/situativ", "grafisch",<br />
"numerisch" <strong>und</strong> "symbolisch"<br />
Die Konstruktion dieser Umgebung folgt den<br />
folgenden Prinzipien:<br />
• Offene Navigation: Jeder <strong>Lernen</strong>de kann<br />
jederzeit überhall hin gehen. Es gibt keine<br />
Lenkung durch das System. Die Vorschläge<br />
an den Lerner sind jedoch strukturiert,<br />
z.B. durch Icons, die die Darstellungsform<br />
des Bibliotheksangebots oder<br />
des Problems charakterisieren. Die D<strong>im</strong>ensionen<br />
"sprachlich/situativ", "gra-<br />
•<br />
fisch", "numerisch" <strong>und</strong> "symbolisch" ziehen<br />
sich durch das ganze System.<br />
Universelle Werkzeuge: Wenige, allgemein<br />
nutzbare mathematische Werkzeuge;<br />
keine Spezialtools zur Lösung einzelner<br />
Probleme<br />
• Einstieg von oben: Komplexe Probleme<br />
führen in mathematische Fragen ein.<br />
Training in Gr<strong>und</strong>fertigkeiten ist instrumentell.<br />
• Verzweigende Vielfalt statt Kursprinzip:<br />
Der Lerner entscheidet über seine<br />
Lernwege <strong>und</strong> Lernziele. Die Lernervoraussetzungen<br />
sind unterschiedlich.<br />
• Selbsteinschätzung vor Diagnose: Eine<br />
"Fern"diagnose in Form eines Selbstdiagnosetestes<br />
bietet das System nur auf<br />
Anfrage an. Das Lernermodell erwächst<br />
pr<strong>im</strong>är aus der Selbsteinschätzung, nicht<br />
aus der Beurteilung des Systems.<br />
• Reflexionsanregende Instrumente: Die<br />
individuelle Wahl von Darstellungsformen,<br />
die Arbeitsmappe, der Strategienpool sowie<br />
das Selbstseinschätzungsmodul regen<br />
den <strong>Lernen</strong>den an, seine Kompetenzen<br />
bewusst zu reflektieren.<br />
Das Problem, das man sich durch die Offenheit<br />
der möglichen Lernwege einhandelt, ist<br />
die mit der Navigation verb<strong>und</strong>ene, so genannte<br />
kognitive Überlastung. Das notorische<br />
Phänomen bei der Rezeption von Hypertexten,<br />
das gleichsam exponentiell mit ihrer<br />
Konnektivität anwächst, lautet "lost in hyperspace".<br />
Die Desorientierung des <strong>Lernen</strong>den<br />
über seine Herkunft, seine aktuelle Position<br />
<strong>und</strong> seine möglichen Wege sowie die<br />
fehlende Übersicht über seinen Lernweg <strong>im</strong><br />
Gesamtkontext können zu Frustration <strong>und</strong><br />
Lernabbruch führen. Dies kann durch den<br />
Einsatz von unterschiedlichen Navigationshilfen<br />
vermieden werden (vgl. Blumstengel<br />
1998). Man beachte die metaphorische Fantasie<br />
bei der Bezeichnung solcher Hilfen:<br />
20<br />
• Netzwerke <strong>und</strong> Landkarten (z.B. als advanced<br />
organizer). Mit ihnen kann der<br />
Lerner <strong>im</strong> Prinzip eine globale Lernplanung<br />
in einer komplexen Struktur durchführen.<br />
Dies stellt jedoch hohe Anforderungen.<br />
Solche cognitive maps können<br />
als semantisches Netz sogar zum Konstruktionsprinzip<br />
einer modularen Wissensbasis<br />
werden (Seeger 2003).<br />
• Tourvorschläge (guided tours, trails) sind<br />
vorgefertigte lineare Durchgänge durch<br />
einen Hypertext. Sie können als didaktischer<br />
roter Faden dienen <strong>und</strong> Lerner bei<br />
der Navigation unterstützen.<br />
• Fischaugensichten (fisheye views) zeigen<br />
die lokale Position <strong>und</strong> die nähere Umgebung<br />
an.<br />
• Leseprotokolle (history, backtracking) geben<br />
Informationen über den zurückliegenden<br />
Weg. Solche Informationen lassen<br />
sich auch in die Knoten integrieren.<br />
• Bearbeitungskennzeichen (breadcrumbs)<br />
deuten an, ob <strong>und</strong> wie oft man eine Seite<br />
besucht hat, ggf. auch in welche Richtung<br />
man sie be<strong>im</strong> letzten Mal verlassen hat<br />
(Ariadnefäden).<br />
• Navigationsempfehlungen unterstützen<br />
den <strong>Lernen</strong>den bei der Linkauswahl (next<br />
best).<br />
• Lesezeichen (bookmarks) ermöglichen<br />
dem Lerner, ausgewählte Stellen zu sammeln.<br />
Diese Funktionen lassen sich vielfältig kombinieren<br />
<strong>und</strong> erweitern. Auch können sie<br />
durch virtuelle, grafische Repräsentationssysteme<br />
dargestellt werden (virtuelle 3D-<br />
Welten, Avatare).<br />
Viele Lernumgebungen lassen sich hinsichtlich<br />
des hier explizierten Offenheitskriteriums<br />
klassifizieren:<br />
• Welche Topologie der Lernwege erlaubt<br />
die Lernumgebung?<br />
• Welche Navigationswerkzeuge unterstützten<br />
den <strong>Lernen</strong>den?<br />
• Welche Möglichkeiten der eigenen Mitgestaltung<br />
hat der <strong>Lernen</strong>de?<br />
Beispiele <strong>und</strong> Erfahrungen mit komplexeren<br />
hypermedialen Lernumgebungen für den<br />
schulischen <strong>Mathematik</strong>unterricht sind allerdings<br />
rar. Hinzuweisen ist auf ein Modellprojekt<br />
des Landes NRW, das in Kooperation<br />
mit Schulbuchverlagen <strong>im</strong> Rahmen des Projektes<br />
SelGO ("Selbstlernen in der gymnasialen<br />
Oberstufe") eine Lernplattform erstellt<br />
<strong>und</strong> erprobt (www.selgo.de). Im Bereich der