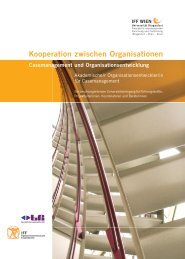Forschungs - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Forschungs - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Forschungs - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ei der forschungspolitischen Kategorienbildung eher zusammengenommen, in anderen (z.B.<br />
Niederlande) sind sie kategorial getrennt. 1<br />
Am offensichtlichsten sind natürlich die Sprachdifferenzen, die immer wieder auch gerne zur<br />
Abschottung des jeweiligen nationalen <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>marktes bemüht werden, wenngleich sich<br />
Englisch als Lingua Franca auch in den SGK-Wissenschaften mehr <strong>und</strong> mehr durchsetzt.<br />
Neben so viel scheinbar unüberbrückbarer Heterogenität sind aber auch gewisse<br />
Annäherungen bzw. gemeinsame Trends zu beobachten. Wenn auch transnationale<br />
<strong><strong>Forschung</strong>s</strong>förderungen auf EU-Ebene für die SGK-Wissenschaften bislang eine noch eher<br />
marginale Rolle spielen, ist doch ein eindeutig zu beobachtender Effekt der EU <strong>und</strong> ihrer<br />
Nationenprogramme (der auch längst wissenschaftlich dokumentiert ist) zu beobachten:<br />
nahezu alle nationalen <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>systeme in Europa machen seit den frühen Neunzigerjahren<br />
einen mehr oder weniger tief greifenden Wandlungsprozess durch. Und viele dieser<br />
nationalen Veränderungen gehen in eine ähnliche Richtung – nicht nur, was die höhere <strong>und</strong><br />
bessere Abstimmung der nationalen <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>förderungen auf der internationalen Seite<br />
anbetrifft (vgl. Senker et al. 1999).<br />
Idealtypisch lassen sich die untersuchten Länder in zwei Gruppen unterteilen:<br />
<strong><strong>Forschung</strong>s</strong>politische Systeme, bei denen in <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>fonds <strong>und</strong> -räten die traditionelle<br />
akademische Elite dominiert. Diese <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>förderungseinrichtungen sind überwiegend<br />
disziplinär orientiert, funktionieren in der Regel nach dem so genannten „bottom-up“-Prinzip<br />
<strong>und</strong> sind in ihren Verfahren nur semi-transparent. Das gilt für Länder wie Österreich,<br />
Deutschland oder Frankreich. In diesen Ländern gibt es in der Regel auch große Probleme mit<br />
dem wissenschaftlichen Nachwuchs.<br />
Modernisierte forschungspolitische Systeme finden sich in Ländern wie Großbritannien,<br />
Norwegen oder Finnland. Mitten in der Phase der Transformation befinden sich Länder wie<br />
die Schweiz, Schweden <strong>und</strong> die Niederlande. „Modernisierung“ forschungspolitischer<br />
Systeme bedeutet dabei zum einen, dass es einen oder mehrere <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>förderungsfonds<br />
gibt, die in relativer Autonomie zum Ministerium stehen. Im Ministerium sind allenthalben<br />
noch die Belange der – zumeist ebenfalls bereits autonomen – Universitäten angesiedelt. Zum<br />
anderen sind die <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>räte in der traditionellen Dichotomie „bottom-up“ versus „topdown“<br />
sehr viel stärker top-down organisiert. Das heißt, es gibt einen zumeist bereits<br />
überwiegenden Bereich an Schwerpunktprogrammen, die freilich nicht allein aus rein<br />
wissenschaftlich-akademischen Überlegungen gebildet wurden. Zumeist gehen diese<br />
Schwerpunkte auf ein ausgeklügeltes System von Programmkomitees zurück, in denen<br />
sowohl gesellschaftliche, politische <strong>und</strong> auch wissenschaftliche Interessen repräsentiert sind.<br />
Vorgeschaltet sind solchen Kommissionen oft sind so genannte Foresight-Studies, also<br />
Zukunftsstudien, mit denen nach unterschiedlichen Verfahren wissenschaftlich <strong>und</strong>/oder<br />
gesellschaftlich relevante Problemgebiete benannt werden.<br />
Ein gemeinsamer Trend in den untersuchten Ländern lässt sich folgendermaßen beschreiben:<br />
<strong><strong>Forschung</strong>s</strong>förderung wird weiter weg vom Staat hin zu autonomen oder semi-autonomen<br />
Einrichtungen delegiert. In vielen Ländern ist überdies eine stärkere Konzentration <strong>und</strong><br />
Abstimmung der fördernden Einrichtungen beobachtbar: so hat man in den skandinavischen<br />
Ländern in den vergangenen Jahren aus vielen kleinen Fonds auch im Bereich der SGK-<br />
1<br />
Dort unterscheidet man zwischen Alpha-, Beta- <strong>und</strong> Gamma-Wissenschaften. Alpha sind die<br />
Geisteswissenschaften, Beta die Naturwissenschaften <strong>und</strong> Gamma die Sozialwissenschaften. In der vorliegenden<br />
Studie wurden die SGK-Wissenschaften zusammenbetrachtet.<br />
10