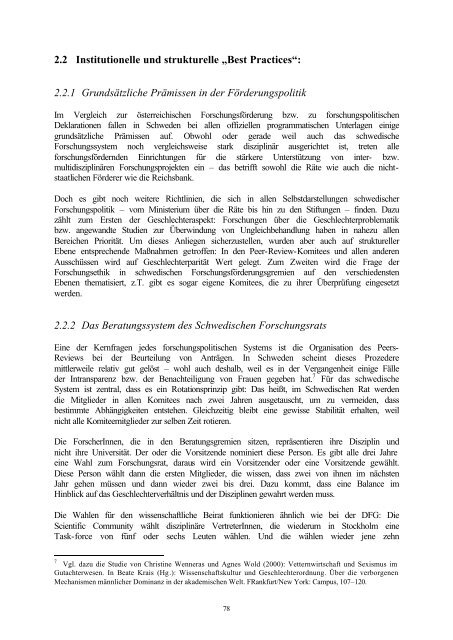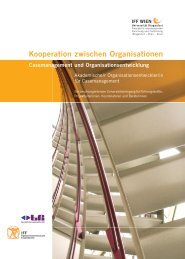Forschungs - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Forschungs - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Forschungs - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.2 Institutionelle <strong>und</strong> strukturelle „Best Practices“:<br />
2.2.1 Gr<strong>und</strong>sätzliche Prämissen in der Förderungspolitik<br />
Im Vergleich zur österreichischen <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>förderung bzw. zu forschungspolitischen<br />
Deklarationen fallen in Schweden bei allen offiziellen programmatischen Unterlagen einige<br />
gr<strong>und</strong>sätzliche Prämissen auf. Obwohl oder gerade weil auch das schwedische<br />
<strong><strong>Forschung</strong>s</strong>system noch vergleichsweise stark disziplinär ausgerichtet ist, treten alle<br />
forschungsfördernden Einrichtungen für die stärkere Unterstützung von inter- bzw.<br />
multidisziplinären <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>projekten ein – das betrifft sowohl die Räte wie auch die nichtstaatlichen<br />
Förderer wie die Reichsbank.<br />
Doch es gibt noch weitere Richtlinien, die sich in allen Selbstdarstellungen schwedischer<br />
<strong><strong>Forschung</strong>s</strong>politik – vom Ministerium über die Räte bis hin zu den Stiftungen – finden. Dazu<br />
zählt zum Ersten der Geschlechteraspekt: <strong>Forschung</strong>en über die Geschlechterproblematik<br />
bzw. angewandte Studien zur Überwindung von Ungleichbehandlung haben in nahezu allen<br />
Bereichen Priorität. Um dieses Anliegen sicherzustellen, wurden aber auch auf struktureller<br />
Ebene entsprechende Maßnahmen getroffen: In den Peer-Review-Komitees <strong>und</strong> allen anderen<br />
Ausschüssen wird auf Geschlechterparität Wert gelegt. Zum Zweiten wird die Frage der<br />
<strong><strong>Forschung</strong>s</strong>ethik in schwedischen <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>förderungsgremien auf den verschiedensten<br />
Ebenen thematisiert, z.T. gibt es sogar eigene Komitees, die zu ihrer Überprüfung eingesetzt<br />
werden.<br />
2.2.2 Das Beratungssystem des Schwedischen <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>rats<br />
Eine der Kernfragen jedes forschungspolitischen Systems ist die Organisation des Peers-<br />
Reviews bei der Beurteilung von Anträgen. In Schweden scheint dieses Prozedere<br />
mittlerweile relativ gut gelöst – wohl auch deshalb, weil es in der Vergangenheit einige Fälle<br />
der Intransparenz bzw. der Benachteiligung von Frauen gegeben hat. 7 Für das schwedische<br />
System ist zentral, dass es ein Rotationsprinzip gibt: Das heißt, im Schwedischen Rat werden<br />
die Mitglieder in allen Komitees nach zwei Jahren ausgetauscht, um zu vermeiden, dass<br />
bestimmte Abhängigkeiten entstehen. Gleichzeitig bleibt eine gewisse Stabilität erhalten, weil<br />
nicht alle Komiteemitglieder zur selben Zeit rotieren.<br />
Die ForscherInnen, die in den Beratungsgremien sitzen, repräsentieren ihre Disziplin <strong>und</strong><br />
nicht ihre Universität. Der oder die Vorsitzende nominiert diese Person. Es gibt alle drei Jahre<br />
eine Wahl zum <strong><strong>Forschung</strong>s</strong>rat, daraus wird ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende gewählt.<br />
Diese Person wählt dann die ersten Mitglieder, die wissen, dass zwei von ihnen im nächsten<br />
Jahr gehen müssen <strong>und</strong> dann wieder zwei bis drei. Dazu kommt, dass eine Balance im<br />
Hinblick auf das Geschlechterverhältnis <strong>und</strong> der Disziplinen gewahrt werden muss.<br />
Die Wahlen für den wissenschaftliche Beirat funktionieren ähnlich wie bei der DFG: Die<br />
Scientific Community wählt disziplinäre VertreterInnen, die wiederum in Stockholm eine<br />
Task-force von fünf oder sechs Leuten wählen. Und die wählen wieder jene zehn<br />
7<br />
Vgl. dazu die Studie von Christine Wenneras <strong>und</strong> Agnes Wold (2000): Vetternwirtschaft <strong>und</strong> Sexismus im<br />
Gutachterwesen. In Beate Krais (Hg.): Wissenschaftskultur <strong>und</strong> Geschlechterordnung. Über die verborgenen<br />
Mechanismen männlicher Dominanz in der akademischen Welt. FRankfurt/New York: Campus, 107–120.<br />
78