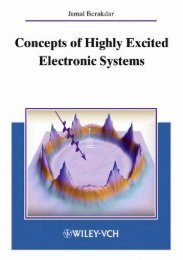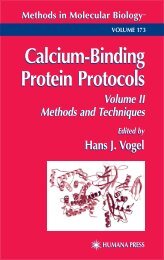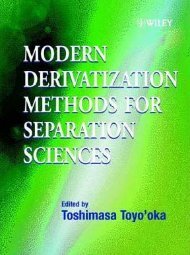Technische Optik in der Praxis
Technische Optik in der Praxis
Technische Optik in der Praxis
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
142 5 Optische Werkstoffe<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit aufgebrochen werden. Der Übergang von e<strong>in</strong>er extrem<br />
zähflüssigen Schmelze zu e<strong>in</strong>em eher festkörperähnlichen Verhalten läßt sich<br />
durch e<strong>in</strong>e Messung des Koeffizienten <strong>der</strong> thermischen Ausdehnung α gut<br />
beobachten; die Übergangstemperatur wird Transformationstemperatur Tg<br />
genannt. Oberhalb Tg ist α im Vergleich zu Temperaturen unterhalb Tg um<br />
e<strong>in</strong>en Faktor von m<strong>in</strong>destens 2 bis 3 größer. Etwa 50 ◦ C bis 100 ◦ C oberhalb<br />
Tg bauen sich Spannungen <strong>in</strong>nerhalb weniger M<strong>in</strong>uten ab. Kühlt man e<strong>in</strong><br />
Glas von Temperaturen oberhalb Tg mit großer Kühlgeschw<strong>in</strong>digkeit (z. B.<br />
100 ◦ C/h) auf Raumtemperatur, so stellt sich von außen nach <strong>in</strong>nen e<strong>in</strong> Temperaturprofil<br />
mit e<strong>in</strong>em Temperaturmaximum im Innern e<strong>in</strong>. Deshalb verbleiben<br />
die <strong>in</strong>neren Teile des Glases länger bei hohen Temperaturen, bei denen<br />
das Glas weiter relaxiert. E<strong>in</strong>e Konsequenz davon ist, daß die Brechzahl<br />
im Innern höher ist als <strong>in</strong> den Bereichen nahe <strong>der</strong> Oberflächen. Um dies<br />
zu vermeiden, muß man das Glas h<strong>in</strong>reichend langsam kühlen. Zusätzlich<br />
kühlt man noch von Temperaturen oberhalb Tg mit konstanter (langsamer)<br />
Kühlgeschw<strong>in</strong>digkeit. Damit wird erreicht, daß alle Teile des produzierten<br />
Glases annähernd die gleiche thermische Vorgeschichte haben und Inhomogenitäten<br />
<strong>der</strong> Brechzahlen durch unterschiedliche Relaxation stark verm<strong>in</strong><strong>der</strong>t<br />
werden.<br />
Es ist nun aber zu erwarten, daß die Brechzahl von <strong>der</strong> (langsamen!)<br />
Kühlgeschw<strong>in</strong>digkeit abhängt. Diese Zusammenhänge kann man dazu ausnutzen,<br />
die Brechzahlen und <strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerem Maße die Dispersion, bzw. die<br />
Abbe-Zahl, zu än<strong>der</strong>n und an die Erfor<strong>der</strong>nisse <strong>der</strong> Konstruktion anzupassen.<br />
Empirisch wurde gefunden, daß sich die Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Brechzahl ∆nd<br />
und <strong>der</strong> Abbe-Zahl ∆νd mit <strong>der</strong> Kühlgeschw<strong>in</strong>digkeit v über große Bereiche<br />
von v durch logarithmische Gesetze beschreiben lassen:<br />
<br />
v<br />
v<br />
∆nd = md log<br />
(5.12)<br />
und<br />
∆νd<br />
v1<br />
<br />
v<br />
v1<br />
v1<br />
= mvd log<br />
<br />
v<br />
v1<br />
(5.13)<br />
In Gleichung (5.12) und (5.13) bedeuten v die neu vorgesehene Kühlgeschw<strong>in</strong>digkeit<br />
und v1 die vorhergehende Kühlgeschw<strong>in</strong>digkeit (o<strong>der</strong> Referenzkühlgeschw<strong>in</strong>digkeit).<br />
Die Konstanten md und mνd (o<strong>der</strong> die Steigungen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er logarithmischen Darstellung <strong>der</strong> Gleichungen (5.12) und (5.13))<br />
müssen für jede Glasart experimentell bestimmt werden. Beide Gleichungen<br />
gelten nicht <strong>in</strong> den Grenzfällen v →∞und v → 0, da die Logarithmusfunktion<br />
divergiert. In <strong>der</strong> <strong>Praxis</strong> können beide Fälle nicht realisiert werden:<br />
Im ersten Fall ist extrem schnelle Kühlung erfor<strong>der</strong>lich, und im zweiten<br />
Fall werden nicht realisierbare lange Zeitdauern zur Kühlung benötigt. Beide<br />
Grenzfälle s<strong>in</strong>d somit für die <strong>Praxis</strong> ohne Bedeutung.<br />
Die Abb. 5.9 und 5.10 stellen für e<strong>in</strong>ige Beispiele an Gläsern ∆nd und ∆νd<br />
<strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Kühlgeschw<strong>in</strong>digkeit dar. Die Referenzkühlgeschw<strong>in</strong>-