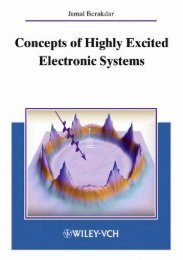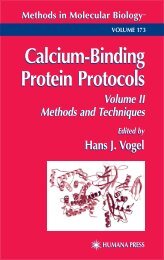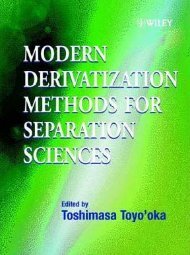- Seite 2:
Technische Optik in der Praxis
- Seite 6:
Professor Dr. Gerd Litfin LINOS AG
- Seite 10:
VI Vorwort zur dritten Auflage Ich
- Seite 14:
VIII Vorwort zur ersten Auflage Die
- Seite 18:
X Inhaltsverzeichnis 3 Abbildungsfe
- Seite 22:
XII Inhaltsverzeichnis 8 Fasern und
- Seite 26:
Autorenverzeichnis Kap. 1: Geometri
- Seite 30:
2 1 Geometrische Optik 1.2 Reflexio
- Seite 34:
4 1 Geometrische Optik Abb. 1.3. Ab
- Seite 38:
6 1 Geometrische Optik Abb. 1.5. Br
- Seite 42:
8 1 Geometrische Optik Abb. 1.8. Ab
- Seite 46:
10 1 Geometrische Optik Abb. 1.10.
- Seite 50:
12 1 Geometrische Optik Tabelle 1.2
- Seite 54:
14 1 Geometrische Optik n n 1 2 S S
- Seite 58:
16 1 Geometrische Optik n n 1 2 σ
- Seite 62:
18 1 Geometrische Optik Der Lichtst
- Seite 66:
20 1 Geometrische Optik ε1 ϕ ε
- Seite 70:
22 1 Geometrische Optik F S a) n n
- Seite 74:
24 1 Geometrische Optik dieses Gege
- Seite 78:
26 1 Geometrische Optik von dicken
- Seite 82:
28 1 Geometrische Optik y 1 F 1 g b
- Seite 86:
30 1 Geometrische Optik Die Brechun
- Seite 90:
32 1 Geometrische Optik F g Linse 1
- Seite 94:
34 1 Geometrische Optik y 1 ω P 1
- Seite 98:
36 2 Wellenoptik durch Vektoren (E
- Seite 102:
38 2 Wellenoptik Abb. 2.1. Ebene We
- Seite 106:
40 2 Wellenoptik ihre Oszillationsf
- Seite 110:
42 2 Wellenoptik E1(x, y, z, t) =E0
- Seite 114:
44 2 Wellenoptik Eingangsintensitä
- Seite 118:
46 2 Wellenoptik ter dieser Vorauss
- Seite 122:
48 2 Wellenoptik Re 〈E(t) · E(t
- Seite 126:
50 2 Wellenoptik auch bei ruhenden
- Seite 130:
52 2 Wellenoptik Abb. 2.16. Oberfl
- Seite 134:
54 2 Wellenoptik 2.3.2 Auflösungsv
- Seite 138:
56 2 Wellenoptik wegungsformen für
- Seite 142:
58 2 Wellenoptik Wird die Kristalld
- Seite 146:
60 2 Wellenoptik tor (sog. Analysat
- Seite 150:
62 2 Wellenoptik teilweise reflekti
- Seite 154:
64 2 Wellenoptik Ohne dielektrische
- Seite 158:
66 2 Wellenoptik schränkt, weil tr
- Seite 162:
68 2 Wellenoptik Abb. 2.34. Polaris
- Seite 166:
70 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 170:
72 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 174:
74 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 178:
76 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 182:
78 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 186:
80 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 190:
82 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 194:
84 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 198:
86 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 202:
88 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 206:
90 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 210:
92 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 214:
94 3 Abbildungsfehler und optische
- Seite 218:
96 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 222:
98 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 226:
100 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 230:
102 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 234:
104 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 238:
106 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 242:
108 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 246:
110 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 250:
112 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 254:
114 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 258:
116 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 262:
118 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 266:
120 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 270:
122 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 274:
124 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 278:
126 4 Entwicklung optischer Systeme
- Seite 282:
128 5 Optische Werkstoffe Grenzflä
- Seite 286:
130 5 Optische Werkstoffe Abb. 5.2.
- Seite 290:
132 5 Optische Werkstoffe In Abb. 5
- Seite 294:
134 5 Optische Werkstoffe Oberfläc
- Seite 298:
136 5 Optische Werkstoffe (Die Indi
- Seite 302:
140 5 Optische Werkstoffe • IR-Tr
- Seite 306:
142 5 Optische Werkstoffe Wahrschei
- Seite 310:
144 5 Optische Werkstoffe 5.3.4 Än
- Seite 314:
146 5 Optische Werkstoffe Abb. 5.12
- Seite 318:
148 5 Optische Werkstoffe und K hei
- Seite 322:
150 5 Optische Werkstoffe Abb. 5.15
- Seite 326:
152 5 Optische Werkstoffe die Betr
- Seite 330:
154 5 Optische Werkstoffe Dieser Fa
- Seite 334:
156 5 Optische Werkstoffe Abb. 5.17
- Seite 338:
158 5 Optische Werkstoffe Tabelle 5
- Seite 342:
160 5 Optische Werkstoffe geeignete
- Seite 346:
6 Spezifikation und Fertigung optis
- Seite 350:
Tabelle 6.1. Gebräuchliche Bindung
- Seite 354:
6.1 Fertigungsverfahren 167 Abb. 6.
- Seite 358:
6.2 Fertigungstoleranzen 169 den. I
- Seite 362: 6.2 Fertigungstoleranzen 171 Die kl
- Seite 366: 6.2 Fertigungstoleranzen 173 Abb. 6
- Seite 370: 6.3 Qualitätsmanagement (QM) 175 A
- Seite 374: Abb. 6.11. Beispiel einer Paretoana
- Seite 378: 7 Optoelektronik-Komponenten Optoel
- Seite 382: 7.1 Lichtemitterdioden 181 Abbildun
- Seite 386: 7.1 Lichtemitterdioden 183 Verfügu
- Seite 390: Abb. 7.8. LED-Anordnung mit gemeins
- Seite 394: ohne mit elektrischem Feld U 7.2 Di
- Seite 398: 7.2 Displays 189 und ebenso viele L
- Seite 402: Abb. 7.13. LCD-Matrix 7.3 Detektore
- Seite 406: 7.3 Detektoren 193 Mit fallender We
- Seite 410: 7.3 Detektoren 195 diode meist in S
- Seite 416: 198 7 Optoelektronik-Komponenten 7.
- Seite 420: 200 7 Optoelektronik-Komponenten Ab
- Seite 424: 202 7 Optoelektronik-Komponenten 7.
- Seite 428: 204 7 Optoelektronik-Komponenten Ab
- Seite 432: 206 7 Optoelektronik-Komponenten be
- Seite 436: 208 7 Optoelektronik-Komponenten ge
- Seite 440: 210 8 Fasern und Sensorik Lichtleit
- Seite 444: 212 8 Fasern und Sensorik Abb. 8.4.
- Seite 448: 214 8 Fasern und Sensorik Modenstru
- Seite 452: 216 8 Fasern und Sensorik Abb. 8.7.
- Seite 456: 218 8 Fasern und Sensorik Pulsverbr
- Seite 460: 220 8 Fasern und Sensorik P(t) t x
- Seite 464:
222 8 Fasern und Sensorik 100 α dB
- Seite 468:
224 8 Fasern und Sensorik systeme a
- Seite 472:
226 8 Fasern und Sensorik a b c d 2
- Seite 476:
228 8 Fasern und Sensorik 2w 0 f f
- Seite 480:
230 8 Fasern und Sensorik Wärmesen
- Seite 484:
232 8 Fasern und Sensorik a b c d A
- Seite 488:
234 8 Fasern und Sensorik r a b c n
- Seite 492:
236 8 Fasern und Sensorik eingesetz
- Seite 496:
238 8 Fasern und Sensorik formation
- Seite 500:
240 8 Fasern und Sensorik x 2R x Ab
- Seite 504:
242 8 Fasern und Sensorik in einer
- Seite 508:
9 Laser Das Kunstwort Laser ist ein
- Seite 512:
9.2 Erzeugung von Laserstrahlung 24
- Seite 516:
9.3 Moden 249 Man bezeichnet sie al
- Seite 520:
I(r) =Imax · e −2r2 /w 2 9.4 Aus
- Seite 524:
und eine Rayleigh-Länge (Schärfen
- Seite 528:
2w0 = 4λ f · π D zR = π · w0 2
- Seite 532:
9.6 Lasertypen 257 Exoten unter den
- Seite 536:
10 Neue Laser Mehr als 40 Jahre Ent
- Seite 540:
= I A H @ A , E @ A = I A H 0
- Seite 544:
0 4 5 F E A C A 2 K F E ? D J =
- Seite 548:
10.3 Upconversion Faserlaser 265 st
- Seite 552:
Sachverzeichnis 1-achsig 56 1/f-Rau
- Seite 556:
Dielektrikum 63 dielektrische Schic
- Seite 560:
Glasfaser 210, 211, 215, 224, 230,
- Seite 564:
LC-Displays 186, 187 LCD 179, 186,
- Seite 568:
polarisationserhaltende Faser 219-
- Seite 572:
Spleiße 232 Spot-Diagramm 75, 80 S
- Seite 576:
Druck: Strauss GmbH, Mörlenbach Ve