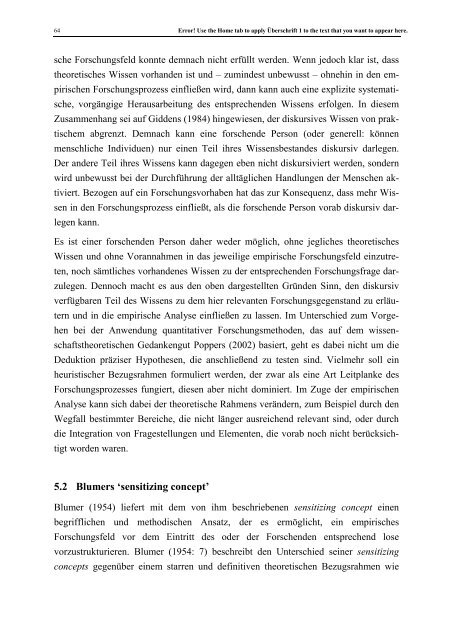Multiple Rationalitäten der kantonalen ... - Universität St.Gallen
Multiple Rationalitäten der kantonalen ... - Universität St.Gallen
Multiple Rationalitäten der kantonalen ... - Universität St.Gallen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
64 Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here.<br />
sche Forschungsfeld konnte demnach nicht erfüllt werden. Wenn jedoch klar ist, dass<br />
theoretisches Wissen vorhanden ist und – zumindest unbewusst – ohnehin in den empirischen<br />
Forschungsprozess einfließen wird, dann kann auch eine explizite systematische,<br />
vorgängige Herausarbeitung des entsprechenden Wissens erfolgen. In diesem<br />
Zusammenhang sei auf Giddens (1984) hingewiesen, <strong>der</strong> diskursives Wissen von praktischem<br />
abgrenzt. Demnach kann eine forschende Person (o<strong>der</strong> generell: können<br />
menschliche Individuen) nur einen Teil ihres Wissensbestandes diskursiv darlegen.<br />
Der an<strong>der</strong>e Teil ihres Wissens kann dagegen eben nicht diskursiviert werden, son<strong>der</strong>n<br />
wird unbewusst bei <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> alltäglichen Handlungen <strong>der</strong> Menschen aktiviert.<br />
Bezogen auf ein Forschungsvorhaben hat das zur Konsequenz, dass mehr Wissen<br />
in den Forschungsprozess einfließt, als die forschende Person vorab diskursiv darlegen<br />
kann.<br />
Es ist einer forschenden Person daher we<strong>der</strong> möglich, ohne jegliches theoretisches<br />
Wissen und ohne Vorannahmen in das jeweilige empirische Forschungsfeld einzutreten,<br />
noch sämtliches vorhandenes Wissen zu <strong>der</strong> entsprechenden Forschungsfrage darzulegen.<br />
Dennoch macht es aus den oben dargestellten Gründen Sinn, den diskursiv<br />
verfügbaren Teil des Wissens zu dem hier relevanten Forschungsgegenstand zu erläutern<br />
und in die empirische Analyse einfließen zu lassen. Im Unterschied zum Vorgehen<br />
bei <strong>der</strong> Anwendung quantitativer Forschungsmethoden, das auf dem wissenschaftstheoretischen<br />
Gedankengut Poppers (2002) basiert, geht es dabei nicht um die<br />
Deduktion präziser Hypothesen, die anschließend zu testen sind. Vielmehr soll ein<br />
heuristischer Bezugsrahmen formuliert werden, <strong>der</strong> zwar als eine Art Leitplanke des<br />
Forschungsprozesses fungiert, diesen aber nicht dominiert. Im Zuge <strong>der</strong> empirischen<br />
Analyse kann sich dabei <strong>der</strong> theoretische Rahmens verän<strong>der</strong>n, zum Beispiel durch den<br />
Wegfall bestimmter Bereiche, die nicht länger ausreichend relevant sind, o<strong>der</strong> durch<br />
die Integration von Fragestellungen und Elementen, die vorab noch nicht berücksichtigt<br />
worden waren.<br />
5.2 Blumers ʻsensitizing conceptʼ<br />
Blumer (1954) liefert mit dem von ihm beschriebenen sensitizing concept einen<br />
begrifflichen und methodischen Ansatz, <strong>der</strong> es ermöglicht, ein empirisches<br />
Forschungsfeld vor dem Eintritt des o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Forschenden entsprechend lose<br />
vorzustrukturieren. Blumer (1954: 7) beschreibt den Unterschied seiner sensitizing<br />
concepts gegenüber einem starren und definitiven theoretischen Bezugsrahmen wie