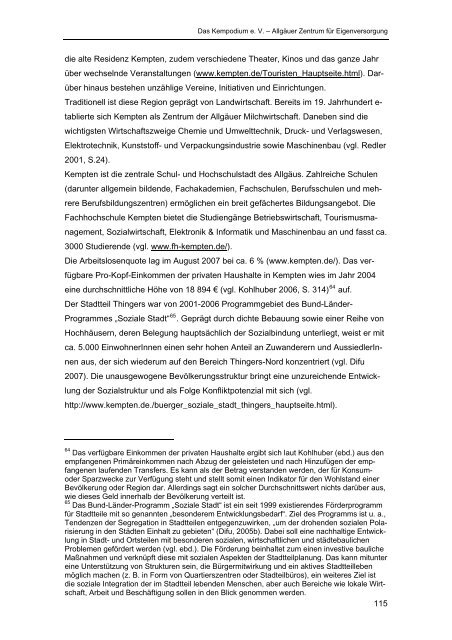I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Kempodium e. V. – Allgäuer Zentrum für Eigenversorgung<br />
die alte Residenz Kempten, zudem verschiedene Theater, Kinos <strong>und</strong> das ganze Jahr<br />
über wechselnde Veranstaltungen (www.kempten.de/Touristen_Hauptseite.html). Darüber<br />
hinaus bestehen unzählige Vereine, Initiativen <strong>und</strong> Einrichtungen.<br />
Traditionell ist diese Region geprägt von Landwirtschaft. Bereits im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert etablierte<br />
sich Kempten als Zentrum der Allgäuer Milchwirtschaft. Daneben sind die<br />
wichtigsten Wirtschaftszweige Chemie <strong>und</strong> Umwelttechnik, Druck- <strong>und</strong> Verlagswesen,<br />
Elektrotechnik, Kunststoff- <strong>und</strong> Verpackungsindustrie sowie Maschinenbau (vgl. Redler<br />
2001, S.24).<br />
Kempten ist die zentrale Schul- <strong>und</strong> Hochschulstadt des Allgäus. Zahlreiche Schulen<br />
(darunter allgemein bildende, Fachakademien, Fachschulen, Berufsschulen <strong>und</strong> mehrere<br />
Berufsbildungszentren) ermöglichen ein breit gefächertes Bildungsangebot. Die<br />
Fachhochschule Kempten bietet die Studiengänge Betriebswirtschaft, Tourismusmanagement,<br />
Sozialwirtschaft, Elektronik & Informatik <strong>und</strong> Maschinenbau an <strong>und</strong> fasst ca.<br />
3000 Studierende (vgl. www.fh-kempten.de/).<br />
Die <strong>Arbeit</strong>slosenquote lag im August 2007 bei ca. 6 % (www.kempten.de/). Das verfügbare<br />
Pro-Kopf-Einkommen der privaten Haushalte in Kempten wies im Jahr 2004<br />
eine durchschnittliche Höhe von 18 894 € (vgl. Kohlhuber 2006, S. 314) 64 auf.<br />
Der Stadtteil Thingers war von 2001-2006 Programmgebiet des B<strong>und</strong>-Länder-<br />
Programmes „<strong>Soziale</strong> Stadt“ 65 . Geprägt durch dichte Bebauung sowie einer Reihe von<br />
Hochhäusern, deren Belegung hauptsächlich der Sozialbindung unterliegt, weist er mit<br />
ca. 5.000 EinwohnerInnen einen sehr hohen Anteil an Zuwanderern <strong>und</strong> AussiedlerInnen<br />
aus, der sich wiederum auf den Bereich Thingers-Nord konzentriert (vgl. Difu<br />
2007). Die unausgewogene Bevölkerungsstruktur bringt eine unzureichende Entwicklung<br />
der Sozialstruktur <strong>und</strong> als Folge Konfliktpotenzial mit sich (vgl.<br />
http://www.kempten.de./buerger_soziale_stadt_thingers_hauptseite.html).<br />
64 Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte ergibt sich laut Kohlhuber (ebd.) aus den<br />
empfangenen Primäreinkommen nach Abzug der geleisteten <strong>und</strong> nach Hinzufügen der empfangenen<br />
laufenden Transfers. Es kann als der Betrag verstanden werden, der für Konsum-<br />
oder Sparzwecke zur Verfügung steht <strong>und</strong> stellt somit einen Indikator für den Wohlstand einer<br />
Bevölkerung oder Region dar. Allerdings sagt ein solcher Durchschnittswert nichts darüber aus,<br />
wie dieses Geld innerhalb der Bevölkerung verteilt ist.<br />
65 Das B<strong>und</strong>-Länder-Programm „<strong>Soziale</strong> Stadt“ ist ein seit 1999 existierendes Förderprogramm<br />
für Stadtteile mit so genannten „besonderem Entwicklungsbedarf“. Ziel des Programms ist u. a.,<br />
Tendenzen der Segregation in Stadtteilen entgegenzuwirken, „um der drohenden sozialen Polarisierung<br />
in den Städten Einhalt zu gebieten“ (Difu, 2005b). Dabei soll eine nachhaltige Entwicklung<br />
in Stadt- <strong>und</strong> Ortsteilen mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen <strong>und</strong> städtebaulichen<br />
Problemen gefördert werden (vgl. ebd.). Die Förderung beinhaltet zum einen investive bauliche<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> verknüpft diese mit sozialen Aspekten der Stadtteilplanung. Das kann mitunter<br />
eine Unterstützung von Strukturen sein, die Bürgermitwirkung <strong>und</strong> ein aktives Stadtteilleben<br />
möglich machen (z. B. in Form von Quartierszentren oder Stadteilbüros), ein weiteres Ziel ist<br />
die soziale Integration der im Stadtteil lebenden Menschen, aber auch Bereiche wie lokale Wirtschaft,<br />
<strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> Beschäftigung sollen in den Blick genommen werden.<br />
115