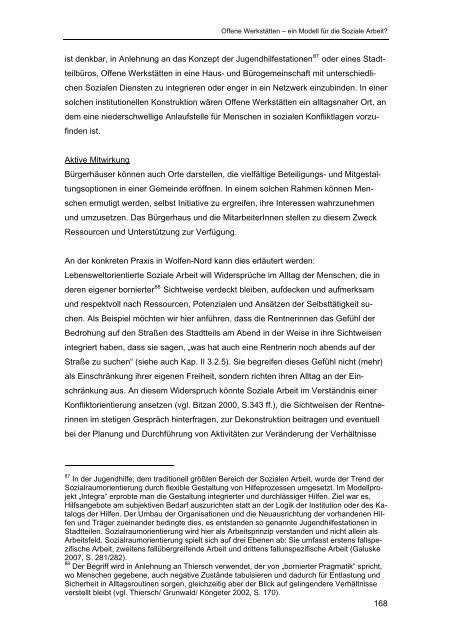I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Offene Werkstätten – ein Modell für die <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong>?<br />
ist denkbar, in Anlehnung an das Konzept der Jugendhilfestationen 87 oder eines Stadt-<br />
teilbüros, Offene Werkstätten in eine Haus- <strong>und</strong> Bürogemeinschaft mit unterschiedlichen<br />
<strong>Soziale</strong>n Diensten zu integrieren oder enger in ein Netzwerk einzubinden. In einer<br />
solchen institutionellen Konstruktion wären Offene Werkstätten ein alltagsnaher Ort, an<br />
dem eine niederschwellige Anlaufstelle für Menschen in sozialen Konfliktlagen vorzufinden<br />
ist.<br />
Aktive Mitwirkung<br />
Bürgerhäuser können auch Orte darstellen, die vielfältige Beteiligungs- <strong>und</strong> Mitgestaltungsoptionen<br />
in einer Gemeinde eröffnen. In einem solchen Rahmen können Menschen<br />
ermutigt werden, selbst Initiative zu ergreifen, ihre Interessen wahrzunehmen<br />
<strong>und</strong> umzusetzen. Das Bürgerhaus <strong>und</strong> die MitarbeiterInnen stellen zu diesem Zweck<br />
Ressourcen <strong>und</strong> Unterstützung zur Verfügung.<br />
An der konkreten Praxis in Wolfen-Nord kann dies erläutert werden:<br />
Lebensweltorientierte <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> will Widersprüche im Alltag der Menschen, die in<br />
deren eigener bornierter 88 Sichtweise verdeckt bleiben, aufdecken <strong>und</strong> aufmerksam<br />
<strong>und</strong> respektvoll nach Ressourcen, Potenzialen <strong>und</strong> Ansätzen der Selbsttätigkeit suchen.<br />
Als Beispiel möchten wir hier anführen, dass die Rentnerinnen das Gefühl der<br />
Bedrohung auf den Straßen des Stadtteils am Abend in der Weise in ihre Sichtweisen<br />
integriert haben, dass sie sagen, „was hat auch eine Rentnerin noch abends auf der<br />
Straße zu suchen“ (siehe auch Kap. II 3.2.5). Sie begreifen dieses Gefühl nicht (mehr)<br />
als Einschränkung ihrer eigenen Freiheit, sondern richten ihren Alltag an der Einschränkung<br />
aus. An diesem Widerspruch könnte <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> im Verständnis einer<br />
Konfliktorientierung ansetzen (vgl. Bitzan 2000, S.343 ff.), die Sichtweisen der Rentnerinnen<br />
im stetigen Gespräch hinterfragen, zur Dekonstruktion beitragen <strong>und</strong> eventuell<br />
bei der Planung <strong>und</strong> Durchführung von Aktivitäten zur Veränderung der Verhältnisse<br />
87 In der Jugendhilfe, dem traditionell größten Bereich der <strong>Soziale</strong>n <strong>Arbeit</strong>, wurde der Trend der<br />
Sozialraumorientierung durch flexible Gestaltung von Hilfeprozessen umgesetzt. Im Modellprojekt<br />
„Integra“ erprobte man die Gestaltung integrierter <strong>und</strong> durchlässiger Hilfen. Ziel war es,<br />
Hilfsangebote am subjektiven Bedarf auszurichten statt an der Logik der Institution oder des Katalogs<br />
der Hilfen. Der Umbau der Organisationen <strong>und</strong> die Neuausrichtung der vorhandenen Hilfen<br />
<strong>und</strong> Träger zueinander bedingte dies, es entstanden so genannte Jugendhilfestationen in<br />
Stadtteilen. Sozialraumorientierung wird hier als <strong>Arbeit</strong>sprinzip verstanden <strong>und</strong> nicht allein als<br />
<strong>Arbeit</strong>sfeld. Sozialraumorientierung spielt sich auf drei Ebenen ab: Sie umfasst erstens fallspezifische<br />
<strong>Arbeit</strong>, zweitens fallübergreifende <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> drittens fallunspezifische <strong>Arbeit</strong> (Galuske<br />
2007, S. 281/282).<br />
88 Der Begriff wird in Anlehnung an Thiersch verwendet, der von „bornierter Pragmatik“ spricht,<br />
wo Menschen gegebene, auch negative Zustände tabuisieren <strong>und</strong> dadurch für Entlastung <strong>und</strong><br />
Sicherheit in Alltagsroutinen sorgen, gleichzeitig aber der Blick auf gelingendere Verhältnisse<br />
verstellt bleibt (vgl. Thiersch/ Grunwald/ Köngeter 2002, S. 170).<br />
168