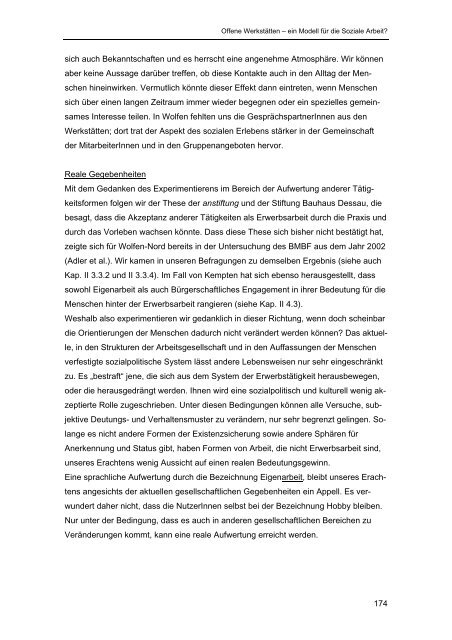I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Offene Werkstätten – ein Modell für die <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong>?<br />
sich auch Bekanntschaften <strong>und</strong> es herrscht eine angenehme Atmosphäre. Wir können<br />
aber keine Aussage darüber treffen, ob diese Kontakte auch in den Alltag der Menschen<br />
hineinwirken. Vermutlich könnte dieser Effekt dann eintreten, wenn Menschen<br />
sich über einen langen Zeitraum immer wieder begegnen oder ein spezielles gemeinsames<br />
Interesse teilen. In Wolfen fehlten uns die GesprächspartnerInnen aus den<br />
Werkstätten; dort trat der Aspekt des sozialen Erlebens stärker in der Gemeinschaft<br />
der MitarbeiterInnen <strong>und</strong> in den Gruppenangeboten hervor.<br />
Reale Gegebenheiten<br />
Mit dem Gedanken des Experimentierens im Bereich der Aufwertung anderer Tätigkeitsformen<br />
folgen wir der These der anstiftung <strong>und</strong> der Stiftung Bauhaus Dessau, die<br />
besagt, dass die Akzeptanz anderer Tätigkeiten als <strong>Erwerbsarbeit</strong> durch die Praxis <strong>und</strong><br />
durch das Vorleben wachsen könnte. Dass diese These sich bisher nicht bestätigt hat,<br />
zeigte sich für Wolfen-Nord bereits in der Untersuchung des BMBF aus dem Jahr 2002<br />
(Adler et al.). Wir kamen in unseren Befragungen zu demselben Ergebnis (siehe auch<br />
Kap. II 3.3.2 <strong>und</strong> II 3.3.4). Im Fall von Kempten hat sich ebenso herausgestellt, dass<br />
sowohl <strong>Eigenarbeit</strong> als auch Bürgerschaftliches Engagement in ihrer Bedeutung für die<br />
Menschen hinter der <strong>Erwerbsarbeit</strong> rangieren (siehe Kap. II 4.3).<br />
Weshalb also experimentieren wir gedanklich in dieser Richtung, wenn doch scheinbar<br />
die Orientierungen der Menschen dadurch nicht verändert werden können? Das aktuelle,<br />
in den Strukturen der <strong>Arbeit</strong>sgesellschaft <strong>und</strong> in den Auffassungen der Menschen<br />
verfestigte sozialpolitische System lässt andere Lebensweisen nur sehr eingeschränkt<br />
zu. Es „bestraft“ jene, die sich aus dem System der Erwerbstätigkeit herausbewegen,<br />
oder die herausgedrängt werden. Ihnen wird eine sozialpolitisch <strong>und</strong> kulturell wenig akzeptierte<br />
Rolle zugeschrieben. Unter diesen Bedingungen können alle Versuche, subjektive<br />
Deutungs- <strong>und</strong> Verhaltensmuster zu verändern, nur sehr begrenzt gelingen. Solange<br />
es nicht andere Formen der Existenzsicherung sowie andere Sphären für<br />
Anerkennung <strong>und</strong> Status gibt, haben Formen von <strong>Arbeit</strong>, die nicht <strong>Erwerbsarbeit</strong> sind,<br />
unseres Erachtens wenig Aussicht auf einen realen Bedeutungsgewinn.<br />
Eine sprachliche Aufwertung durch die Bezeichnung <strong>Eigenarbeit</strong>, bleibt unseres Erachtens<br />
angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten ein Appell. Es verw<strong>und</strong>ert<br />
daher nicht, dass die NutzerInnen selbst bei der Bezeichnung Hobby bleiben.<br />
Nur unter der Bedingung, dass es auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu<br />
Veränderungen kommt, kann eine reale Aufwertung erreicht werden.<br />
174