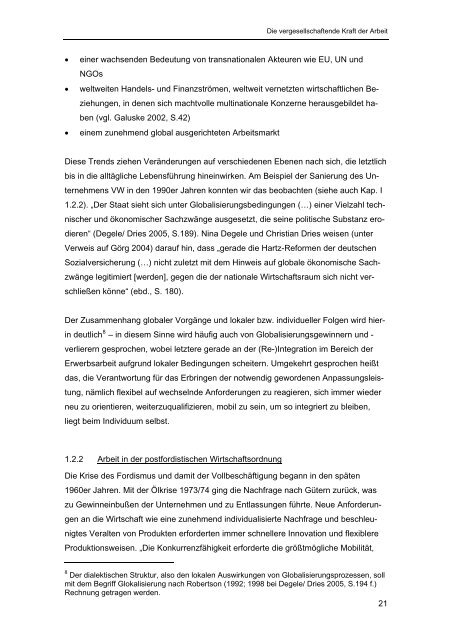I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die vergesellschaftende Kraft der <strong>Arbeit</strong><br />
• einer wachsenden Bedeutung von transnationalen Akteuren wie EU, UN <strong>und</strong><br />
NGOs<br />
• weltweiten Handels- <strong>und</strong> Finanzströmen, weltweit vernetzten wirtschaftlichen Beziehungen,<br />
in denen sich machtvolle multinationale Konzerne herausgebildet haben<br />
(vgl. Galuske 2002, S.42)<br />
• einem zunehmend global ausgerichteten <strong>Arbeit</strong>smarkt<br />
Diese Trends ziehen Veränderungen auf verschiedenen Ebenen nach sich, die letztlich<br />
bis in die alltägliche Lebensführung hineinwirken. Am Beispiel der Sanierung des Unternehmens<br />
VW in den 1990er Jahren konnten wir das beobachten (siehe auch Kap. I<br />
1.2.2). „Der Staat sieht sich unter Globalisierungsbedingungen (…) einer Vielzahl technischer<br />
<strong>und</strong> ökonomischer Sachzwänge ausgesetzt, die seine politische Substanz erodieren“<br />
(Degele/ Dries 2005, S.189). Nina Degele <strong>und</strong> Christian Dries weisen (unter<br />
Verweis auf Görg 2004) darauf hin, dass „gerade die Hartz-Reformen der deutschen<br />
Sozialversicherung (…) nicht zuletzt mit dem Hinweis auf globale ökonomische Sachzwänge<br />
legitimiert [werden], gegen die der nationale Wirtschaftsraum sich nicht verschließen<br />
könne“ (ebd., S. 180).<br />
Der Zusammenhang globaler Vorgänge <strong>und</strong> lokaler bzw. individueller Folgen wird hierin<br />
deutlich 8 – in diesem Sinne wird häufig auch von Globalisierungsgewinnern <strong>und</strong> -<br />
verlierern gesprochen, wobei letztere gerade an der (Re-)Integration im Bereich der<br />
<strong>Erwerbsarbeit</strong> aufgr<strong>und</strong> lokaler Bedingungen scheitern. Umgekehrt gesprochen heißt<br />
das, die Verantwortung für das Erbringen der notwendig gewordenen Anpassungsleistung,<br />
nämlich flexibel auf wechselnde Anforderungen zu reagieren, sich immer wieder<br />
neu zu orientieren, weiterzuqualifizieren, mobil zu sein, um so integriert zu bleiben,<br />
liegt beim Individuum selbst.<br />
1.2.2 <strong>Arbeit</strong> in der postfordistischen Wirtschaftsordnung<br />
Die Krise des Fordismus <strong>und</strong> damit der Vollbeschäftigung begann in den späten<br />
1960er Jahren. Mit der Ölkrise 1973/74 ging die Nachfrage nach Gütern zurück, was<br />
zu Gewinneinbußen der Unternehmen <strong>und</strong> zu Entlassungen führte. Neue Anforderungen<br />
an die Wirtschaft wie eine zunehmend individualisierte Nachfrage <strong>und</strong> beschleunigtes<br />
Veralten von Produkten erforderten immer schnellere Innovation <strong>und</strong> flexiblere<br />
Produktionsweisen. „Die Konkurrenzfähigkeit erforderte die größtmögliche Mobilität,<br />
8 Der dialektischen Struktur, also den lokalen Auswirkungen von Globalisierungsprozessen, soll<br />
mit dem Begriff Glokalisierung nach Robertson (1992; 1998 bei Degele/ Dries 2005, S.194 f.)<br />
Rechnung getragen werden.<br />
21