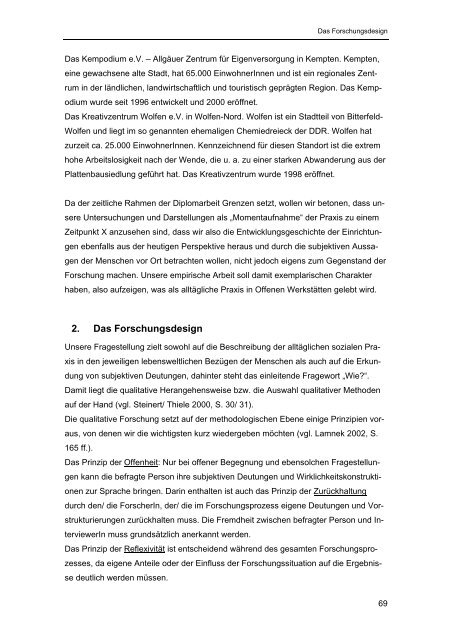I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das Forschungsdesign<br />
Das Kempodium e.V. – Allgäuer Zentrum für Eigenversorgung in Kempten. Kempten,<br />
eine gewachsene alte Stadt, hat 65.000 EinwohnerInnen <strong>und</strong> ist ein regionales Zentrum<br />
in der ländlichen, landwirtschaftlich <strong>und</strong> touristisch geprägten Region. Das Kempodium<br />
wurde seit 1996 entwickelt <strong>und</strong> 2000 eröffnet.<br />
Das Kreativzentrum Wolfen e.V. in Wolfen-Nord. Wolfen ist ein Stadtteil von Bitterfeld-<br />
Wolfen <strong>und</strong> liegt im so genannten ehemaligen Chemiedreieck der DDR. Wolfen hat<br />
zurzeit ca. 25.000 EinwohnerInnen. Kennzeichnend für diesen Standort ist die extrem<br />
hohe <strong>Arbeit</strong>slosigkeit nach der Wende, die u. a. zu einer starken Abwanderung aus der<br />
Plattenbausiedlung geführt hat. Das Kreativzentrum wurde 1998 eröffnet.<br />
Da der zeitliche Rahmen der Diplomarbeit Grenzen setzt, wollen wir betonen, dass unsere<br />
Untersuchungen <strong>und</strong> Darstellungen als „Momentaufnahme“ der Praxis zu einem<br />
Zeitpunkt X anzusehen sind, dass wir also die Entwicklungsgeschichte der Einrichtungen<br />
ebenfalls aus der heutigen Perspektive heraus <strong>und</strong> durch die subjektiven Aussagen<br />
der Menschen vor Ort betrachten wollen, nicht jedoch eigens zum Gegenstand der<br />
Forschung machen. Unsere empirische <strong>Arbeit</strong> soll damit exemplarischen Charakter<br />
haben, also aufzeigen, was als alltägliche Praxis in Offenen Werkstätten gelebt wird.<br />
2. Das Forschungsdesign<br />
Unsere Fragestellung zielt sowohl auf die Beschreibung der alltäglichen sozialen Praxis<br />
in den jeweiligen lebensweltlichen Bezügen der Menschen als auch auf die Erk<strong>und</strong>ung<br />
von subjektiven Deutungen, dahinter steht das einleitende Fragewort „Wie?“.<br />
Damit liegt die qualitative Herangehensweise bzw. die Auswahl qualitativer Methoden<br />
auf der Hand (vgl. Steinert/ Thiele 2000, S. 30/ 31).<br />
Die qualitative Forschung setzt auf der methodologischen Ebene einige Prinzipien voraus,<br />
von denen wir die wichtigsten kurz wiedergeben möchten (vgl. Lamnek 2002, S.<br />
165 ff.).<br />
Das Prinzip der Offenheit: Nur bei offener Begegnung <strong>und</strong> ebensolchen Fragestellungen<br />
kann die befragte Person ihre subjektiven Deutungen <strong>und</strong> Wirklichkeitskonstruktionen<br />
zur Sprache bringen. Darin enthalten ist auch das Prinzip der Zurückhaltung<br />
durch den/ die ForscherIn, der/ die im Forschungsprozess eigene Deutungen <strong>und</strong> Vorstrukturierungen<br />
zurückhalten muss. Die Fremdheit zwischen befragter Person <strong>und</strong> InterviewerIn<br />
muss gr<strong>und</strong>sätzlich anerkannt werden.<br />
Das Prinzip der Reflexivität ist entscheidend während des gesamten Forschungsprozesses,<br />
da eigene Anteile oder der Einfluss der Forschungssituation auf die Ergebnisse<br />
deutlich werden müssen.<br />
69