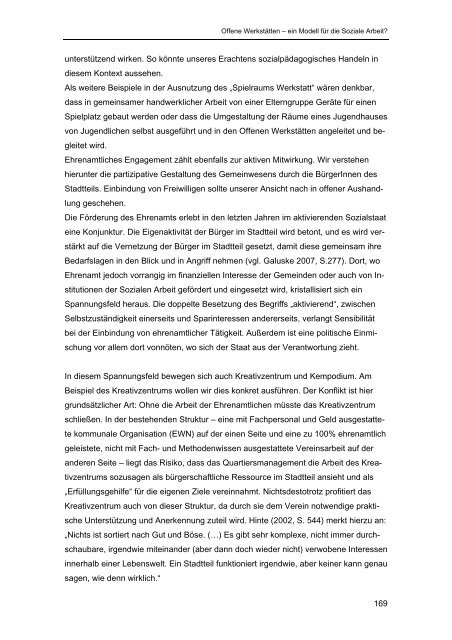I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Offene Werkstätten – ein Modell für die <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong>?<br />
unterstützend wirken. So könnte unseres Erachtens sozialpädagogisches Handeln in<br />
diesem Kontext aussehen.<br />
Als weitere Beispiele in der Ausnutzung des „Spielraums Werkstatt“ wären denkbar,<br />
dass in gemeinsamer <strong>handwerkliche</strong>r <strong>Arbeit</strong> von einer Elterngruppe Geräte für einen<br />
Spielplatz gebaut werden oder dass die Umgestaltung der Räume eines Jugendhauses<br />
von Jugendlichen selbst ausgeführt <strong>und</strong> in den Offenen Werkstätten angeleitet <strong>und</strong> begleitet<br />
wird.<br />
Ehrenamtliches Engagement zählt ebenfalls zur aktiven Mitwirkung. Wir verstehen<br />
hierunter die partizipative Gestaltung des Gemeinwesens durch die BürgerInnen des<br />
Stadtteils. Einbindung von Freiwilligen sollte unserer Ansicht nach in offener Aushandlung<br />
geschehen.<br />
Die Förderung des Ehrenamts erlebt in den letzten Jahren im aktivierenden Sozialstaat<br />
eine Konjunktur. Die Eigenaktivität der Bürger im Stadtteil wird betont, <strong>und</strong> es wird verstärkt<br />
auf die Vernetzung der Bürger im Stadtteil gesetzt, damit diese gemeinsam ihre<br />
Bedarfslagen in den Blick <strong>und</strong> in Angriff nehmen (vgl. Galuske 2007, S.277). Dort, wo<br />
Ehrenamt jedoch vorrangig im finanziellen Interesse der Gemeinden oder auch von Institutionen<br />
der <strong>Soziale</strong>n <strong>Arbeit</strong> gefördert <strong>und</strong> eingesetzt wird, kristallisiert sich ein<br />
Spannungsfeld heraus. Die doppelte Besetzung des Begriffs „aktivierend“, zwischen<br />
Selbstzuständigkeit einerseits <strong>und</strong> Sparinteressen andererseits, verlangt Sensibilität<br />
bei der Einbindung von ehrenamtlicher Tätigkeit. Außerdem ist eine politische Einmischung<br />
vor allem dort vonnöten, wo sich der Staat aus der Verantwortung zieht.<br />
In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch Kreativzentrum <strong>und</strong> Kempodium. Am<br />
Beispiel des Kreativzentrums wollen wir dies konkret ausführen. Der Konflikt ist hier<br />
gr<strong>und</strong>sätzlicher Art: Ohne die <strong>Arbeit</strong> der Ehrenamtlichen müsste das Kreativzentrum<br />
schließen. In der bestehenden Struktur – eine mit Fachpersonal <strong>und</strong> Geld ausgestattete<br />
kommunale Organisation (EWN) auf der einen Seite <strong>und</strong> eine zu 100% ehrenamtlich<br />
geleistete, nicht mit Fach- <strong>und</strong> Methodenwissen ausgestattete Vereinsarbeit auf der<br />
anderen Seite – liegt das Risiko, dass das Quartiersmanagement die <strong>Arbeit</strong> des Kreativzentrums<br />
sozusagen als bürgerschaftliche Ressource im Stadtteil ansieht <strong>und</strong> als<br />
„Erfüllungsgehilfe“ für die eigenen Ziele vereinnahmt. Nichtsdestotrotz profitiert das<br />
Kreativzentrum auch von dieser Struktur, da durch sie dem Verein notwendige praktische<br />
Unterstützung <strong>und</strong> Anerkennung zuteil wird. Hinte (2002, S. 544) merkt hierzu an:<br />
„Nichts ist sortiert nach Gut <strong>und</strong> Böse. (…) Es gibt sehr komplexe, nicht immer durchschaubare,<br />
irgendwie miteinander (aber dann doch wieder nicht) verwobene Interessen<br />
innerhalb einer Lebenswelt. Ein Stadtteil funktioniert irgendwie, aber keiner kann genau<br />
sagen, wie denn wirklich.“<br />
169