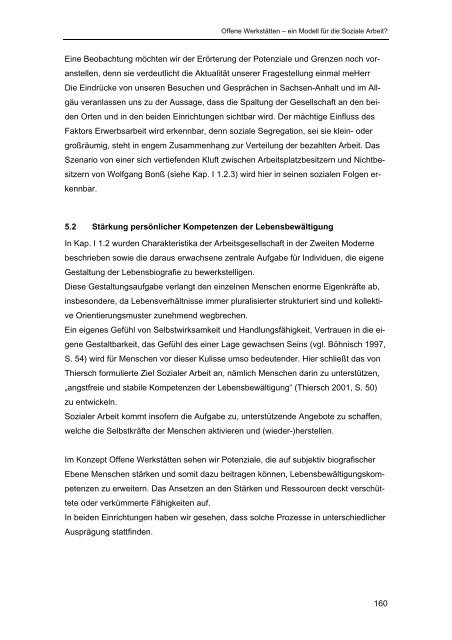I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Offene Werkstätten – ein Modell für die <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong>?<br />
Eine Beobachtung möchten wir der Erörterung der Potenziale <strong>und</strong> Grenzen noch voranstellen,<br />
denn sie verdeutlicht die Aktualität unserer Fragestellung einmal meHerr<br />
Die Eindrücke von unseren Besuchen <strong>und</strong> Gesprächen in Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> im Allgäu<br />
veranlassen uns zu der Aussage, dass die Spaltung der Gesellschaft an den beiden<br />
Orten <strong>und</strong> in den beiden Einrichtungen sichtbar wird. Der mächtige Einfluss des<br />
Faktors <strong>Erwerbsarbeit</strong> wird erkennbar, denn soziale Segregation, sei sie klein- oder<br />
großräumig, steht in engem Zusammenhang zur Verteilung der bezahlten <strong>Arbeit</strong>. Das<br />
Szenario von einer sich vertiefenden Kluft zwischen <strong>Arbeit</strong>splatzbesitzern <strong>und</strong> Nichtbesitzern<br />
von Wolfgang Bonß (siehe Kap. I 1.2.3) wird hier in seinen sozialen Folgen erkennbar.<br />
5.2 Stärkung persönlicher Kompetenzen der Lebensbewältigung<br />
In Kap. I 1.2 wurden Charakteristika der <strong>Arbeit</strong>sgesellschaft in der Zweiten Moderne<br />
beschrieben sowie die daraus erwachsene zentrale Aufgabe für Individuen, die eigene<br />
Gestaltung der Lebensbiografie zu bewerkstelligen.<br />
Diese Gestaltungsaufgabe verlangt den einzelnen Menschen enorme Eigenkräfte ab,<br />
insbesondere, da Lebensverhältnisse immer pluralisierter strukturiert sind <strong>und</strong> kollektive<br />
Orientierungsmuster zunehmend wegbrechen.<br />
Ein eigenes Gefühl von Selbstwirksamkeit <strong>und</strong> Handlungsfähigkeit, Vertrauen in die eigene<br />
Gestaltbarkeit, das Gefühl des einer Lage gewachsen Seins (vgl. Böhnisch 1997,<br />
S. 54) wird für Menschen vor dieser Kulisse umso bedeutender. Hier schließt das von<br />
Thiersch formulierte Ziel <strong>Soziale</strong>r <strong>Arbeit</strong> an, nämlich Menschen darin zu unterstützen,<br />
„angstfreie <strong>und</strong> stabile Kompetenzen der Lebensbewältigung“ (Thiersch 2001, S. 50)<br />
zu entwickeln.<br />
<strong>Soziale</strong>r <strong>Arbeit</strong> kommt insofern die Aufgabe zu, unterstützende Angebote zu schaffen,<br />
welche die Selbstkräfte der Menschen aktivieren <strong>und</strong> (wieder-)herstellen.<br />
Im Konzept Offene Werkstätten sehen wir Potenziale, die auf subjektiv biografischer<br />
Ebene Menschen stärken <strong>und</strong> somit dazu beitragen können, Lebensbewältigungskompetenzen<br />
zu erweitern. Das Ansetzen an den Stärken <strong>und</strong> Ressourcen deckt verschüttete<br />
oder verkümmerte Fähigkeiten auf.<br />
In beiden Einrichtungen haben wir gesehen, dass solche Prozesse in unterschiedlicher<br />
Ausprägung stattfinden.<br />
160