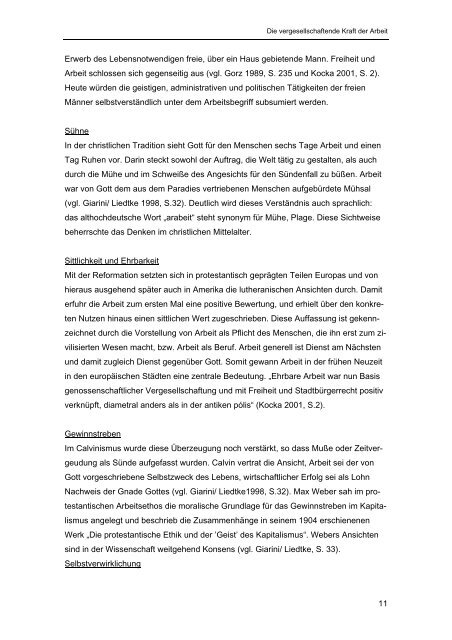I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die vergesellschaftende Kraft der <strong>Arbeit</strong><br />
Erwerb des Lebensnotwendigen freie, über ein Haus gebietende Mann. Freiheit <strong>und</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> schlossen sich gegenseitig aus (vgl. Gorz 1989, S. 235 <strong>und</strong> Kocka 2001, S. 2).<br />
Heute würden die geistigen, administrativen <strong>und</strong> politischen Tätigkeiten der freien<br />
Männer selbstverständlich unter dem <strong>Arbeit</strong>sbegriff subsumiert werden.<br />
Sühne<br />
In der christlichen Tradition sieht Gott für den Menschen sechs Tage <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> einen<br />
Tag Ruhen vor. Darin steckt sowohl der Auftrag, die Welt tätig zu gestalten, als auch<br />
durch die Mühe <strong>und</strong> im Schweiße des Angesichts für den Sündenfall zu büßen. <strong>Arbeit</strong><br />
war von Gott dem aus dem Paradies vertriebenen Menschen aufgebürdete Mühsal<br />
(vgl. Giarini/ Liedtke 1998, S.32). Deutlich wird dieses Verständnis auch sprachlich:<br />
das althochdeutsche Wort „arabeit“ steht synonym für Mühe, Plage. Diese Sichtweise<br />
beherrschte das Denken im christlichen Mittelalter.<br />
Sittlichkeit <strong>und</strong> Ehrbarkeit<br />
Mit der Reformation setzten sich in protestantisch geprägten Teilen Europas <strong>und</strong> von<br />
hieraus ausgehend später auch in Amerika die lutheranischen Ansichten durch. Damit<br />
erfuhr die <strong>Arbeit</strong> zum ersten Mal eine positive Bewertung, <strong>und</strong> erhielt über den konkreten<br />
Nutzen hinaus einen sittlichen Wert zugeschrieben. Diese Auffassung ist gekennzeichnet<br />
durch die Vorstellung von <strong>Arbeit</strong> als Pflicht des Menschen, die ihn erst zum zivilisierten<br />
Wesen macht, bzw. <strong>Arbeit</strong> als Beruf. <strong>Arbeit</strong> generell ist Dienst am Nächsten<br />
<strong>und</strong> damit zugleich Dienst gegenüber Gott. Somit gewann <strong>Arbeit</strong> in der frühen Neuzeit<br />
in den europäischen Städten eine zentrale Bedeutung. „Ehrbare <strong>Arbeit</strong> war nun Basis<br />
genossenschaftlicher Vergesellschaftung <strong>und</strong> mit Freiheit <strong>und</strong> Stadtbürgerrecht positiv<br />
verknüpft, diametral anders als in der antiken pólis“ (Kocka 2001, S.2).<br />
Gewinnstreben<br />
Im Calvinismus wurde diese Überzeugung noch verstärkt, so dass Muße oder Zeitvergeudung<br />
als Sünde aufgefasst wurden. Calvin vertrat die Ansicht, <strong>Arbeit</strong> sei der von<br />
Gott vorgeschriebene Selbstzweck des Lebens, wirtschaftlicher Erfolg sei als Lohn<br />
Nachweis der Gnade Gottes (vgl. Giarini/ Liedtke1998, S.32). Max Weber sah im protestantischen<br />
<strong>Arbeit</strong>sethos die moralische Gr<strong>und</strong>lage für das Gewinnstreben im Kapitalismus<br />
angelegt <strong>und</strong> beschrieb die Zusammenhänge in seinem 1904 erschienenen<br />
Werk „Die protestantische Ethik <strong>und</strong> der ’Geist’ des Kapitalismus“. Webers Ansichten<br />
sind in der Wissenschaft weitgehend Konsens (vgl. Giarini/ Liedtke, S. 33).<br />
Selbstverwirklichung<br />
11