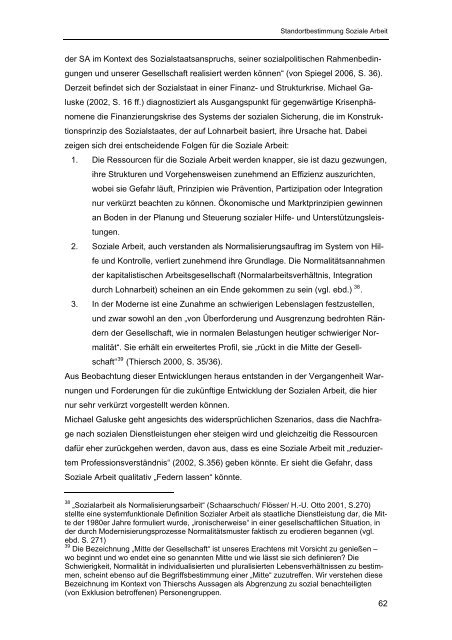I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Standortbestimmung <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
der SA im Kontext des Sozialstaatsanspruchs, seiner sozialpolitischen Rahmenbedingungen<br />
<strong>und</strong> unserer Gesellschaft realisiert werden können“ (von Spiegel 2006, S. 36).<br />
Derzeit befindet sich der Sozialstaat in einer Finanz- <strong>und</strong> Strukturkrise. Michael Galuske<br />
(2002, S. 16 ff.) diagnostiziert als Ausgangspunkt für gegenwärtige Krisenphänomene<br />
die Finanzierungskrise des Systems der sozialen Sicherung, die im Konstruktionsprinzip<br />
des Sozialstaates, der auf Lohnarbeit basiert, ihre Ursache hat. Dabei<br />
zeigen sich drei entscheidende Folgen für die <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong>:<br />
1. Die Ressourcen für die <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> werden knapper, sie ist dazu gezwungen,<br />
ihre Strukturen <strong>und</strong> Vorgehensweisen zunehmend an Effizienz auszurichten,<br />
wobei sie Gefahr läuft, Prinzipien wie Prävention, Partizipation oder Integration<br />
nur verkürzt beachten zu können. Ökonomische <strong>und</strong> Marktprinzipien gewinnen<br />
an Boden in der Planung <strong>und</strong> Steuerung sozialer Hilfe- <strong>und</strong> Unterstützungsleistungen.<br />
2. <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong>, auch verstanden als Normalisierungsauftrag im System von Hilfe<br />
<strong>und</strong> Kontrolle, verliert zunehmend ihre Gr<strong>und</strong>lage. Die Normalitätsannahmen<br />
der kapitalistischen <strong>Arbeit</strong>sgesellschaft (Normalarbeitsverhältnis, Integration<br />
durch Lohnarbeit) scheinen an ein Ende gekommen zu sein (vgl. ebd.) 38 .<br />
3. In der Moderne ist eine Zunahme an schwierigen Lebenslagen festzustellen,<br />
<strong>und</strong> zwar sowohl an den „von Überforderung <strong>und</strong> Ausgrenzung bedrohten Rändern<br />
der Gesellschaft, wie in normalen Belastungen heutiger schwieriger Normalität“.<br />
Sie erhält ein erweitertes Profil, sie „rückt in die Mitte der Gesellschaft“<br />
39 (Thiersch 2000, S. 35/36).<br />
Aus Beobachtung dieser Entwicklungen heraus entstanden in der Vergangenheit Warnungen<br />
<strong>und</strong> Forderungen für die zukünftige Entwicklung der <strong>Soziale</strong>n <strong>Arbeit</strong>, die hier<br />
nur sehr verkürzt vorgestellt werden können.<br />
Michael Galuske geht angesichts des widersprüchlichen Szenarios, dass die Nachfrage<br />
nach sozialen Dienstleistungen eher steigen wird <strong>und</strong> gleichzeitig die Ressourcen<br />
dafür eher zurückgehen werden, davon aus, dass es eine <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> mit „reduziertem<br />
Professionsverständnis“ (2002, S.356) geben könnte. Er sieht die Gefahr, dass<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> qualitativ „Federn lassen“ könnte.<br />
38 „Sozialarbeit als Normalisierungsarbeit“ (Schaarschuch/ Flösser/ H.-U. Otto 2001, S.270)<br />
stellte eine systemfunktionale Definition <strong>Soziale</strong>r <strong>Arbeit</strong> als staatliche Dienstleistung dar, die Mitte<br />
der 1980er Jahre formuliert wurde, „ironischerweise“ in einer gesellschaftlichen Situation, in<br />
der durch Modernisierungsprozesse Normalitätsmuster faktisch zu erodieren begannen (vgl.<br />
ebd. S. 271)<br />
39 Die Bezeichnung „Mitte der Gesellschaft“ ist unseres Erachtens mit Vorsicht zu genießen –<br />
wo beginnt <strong>und</strong> wo endet eine so genannten Mitte <strong>und</strong> wie lässt sie sich definieren? Die<br />
Schwierigkeit, Normalität in individualisierten <strong>und</strong> pluralisierten Lebensverhältnissen zu bestimmen,<br />
scheint ebenso auf die Begriffsbestimmung einer „Mitte“ zuzutreffen. Wir verstehen diese<br />
Bezeichnung im Kontext von Thierschs Aussagen als Abgrenzung zu sozial benachteiligten<br />
(von Exklusion betroffenen) Personengruppen.<br />
62