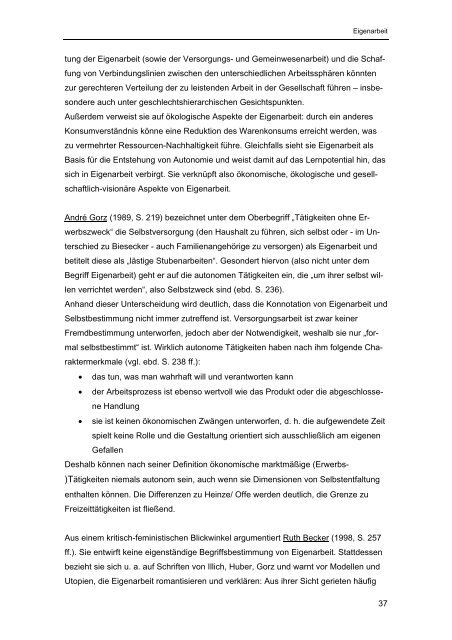I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
I Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, handwerkliche Arbeit und Soziale Arbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Eigenarbeit</strong><br />
tung der <strong>Eigenarbeit</strong> (sowie der Versorgungs- <strong>und</strong> Gemeinwesenarbeit) <strong>und</strong> die Schaffung<br />
von Verbindungslinien zwischen den unterschiedlichen <strong>Arbeit</strong>ssphären könnten<br />
zur gerechteren Verteilung der zu leistenden <strong>Arbeit</strong> in der Gesellschaft führen – insbesondere<br />
auch unter geschlechtshierarchischen Gesichtspunkten.<br />
Außerdem verweist sie auf ökologische Aspekte der <strong>Eigenarbeit</strong>: durch ein anderes<br />
Konsumverständnis könne eine Reduktion des Warenkonsums erreicht werden, was<br />
zu vermehrter Ressourcen-Nachhaltigkeit führe. Gleichfalls sieht sie <strong>Eigenarbeit</strong> als<br />
Basis für die Entstehung von Autonomie <strong>und</strong> weist damit auf das Lernpotential hin, das<br />
sich in <strong>Eigenarbeit</strong> verbirgt. Sie verknüpft also ökonomische, ökologische <strong>und</strong> gesellschaftlich-visionäre<br />
Aspekte von <strong>Eigenarbeit</strong>.<br />
André Gorz (1989, S. 219) bezeichnet unter dem Oberbegriff „Tätigkeiten ohne Erwerbszweck“<br />
die Selbstversorgung (den Haushalt zu führen, sich selbst oder - im Unterschied<br />
zu Biesecker - auch Familienangehörige zu versorgen) als <strong>Eigenarbeit</strong> <strong>und</strong><br />
betitelt diese als „lästige Stubenarbeiten“. Gesondert hiervon (also nicht unter dem<br />
Begriff <strong>Eigenarbeit</strong>) geht er auf die autonomen Tätigkeiten ein, die „um ihrer selbst willen<br />
verrichtet werden“, also Selbstzweck sind (ebd. S. 236).<br />
Anhand dieser Unterscheidung wird deutlich, dass die Konnotation von <strong>Eigenarbeit</strong> <strong>und</strong><br />
Selbstbestimmung nicht immer zutreffend ist. Versorgungsarbeit ist zwar keiner<br />
Fremdbestimmung unterworfen, jedoch aber der Notwendigkeit, weshalb sie nur „formal<br />
selbstbestimmt“ ist. Wirklich autonome Tätigkeiten haben nach ihm folgende Charaktermerkmale<br />
(vgl. ebd. S. 238 ff.):<br />
• das tun, was man wahrhaft will <strong>und</strong> verantworten kann<br />
• der <strong>Arbeit</strong>sprozess ist ebenso wertvoll wie das Produkt oder die abgeschlossene<br />
Handlung<br />
• sie ist keinen ökonomischen Zwängen unterworfen, d. h. die aufgewendete Zeit<br />
spielt keine Rolle <strong>und</strong> die Gestaltung orientiert sich ausschließlich am eigenen<br />
Gefallen<br />
Deshalb können nach seiner Definition ökonomische marktmäßige (Erwerbs-<br />
)Tätigkeiten niemals autonom sein, auch wenn sie Dimensionen von Selbstentfaltung<br />
enthalten können. Die Differenzen zu Heinze/ Offe werden deutlich, die Grenze zu<br />
Freizeittätigkeiten ist fließend.<br />
Aus einem kritisch-feministischen Blickwinkel argumentiert Ruth Becker (1998, S. 257<br />
ff.). Sie entwirft keine eigenständige Begriffsbestimmung von <strong>Eigenarbeit</strong>. Stattdessen<br />
bezieht sie sich u. a. auf Schriften von Illich, Huber, Gorz <strong>und</strong> warnt vor Modellen <strong>und</strong><br />
Utopien, die <strong>Eigenarbeit</strong> romantisieren <strong>und</strong> verklären: Aus ihrer Sicht gerieten häufig<br />
37