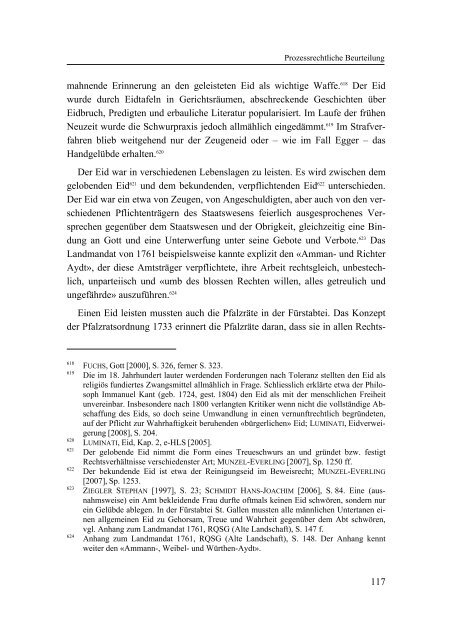Pfalzrätliche Strafuntersuchung gegen Joseph Antoni Egger aus ...
Pfalzrätliche Strafuntersuchung gegen Joseph Antoni Egger aus ...
Pfalzrätliche Strafuntersuchung gegen Joseph Antoni Egger aus ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Prozessrechtliche Beurteilung<br />
mahnende Erinnerung an den geleisteten Eid als wichtige Waffe. 618 Der Eid<br />
wurde durch Eidtafeln in Gerichtsräumen, abschreckende Geschichten über<br />
Eidbruch, Predigten und erbauliche Literatur popularisiert. Im Laufe der frühen<br />
Neuzeit wurde die Schwurpraxis jedoch allmählich eingedämmt. 619 Im Strafverfahren<br />
blieb weitgehend nur der Zeugeneid oder – wie im Fall <strong>Egger</strong> – das<br />
Handgelübde erhalten. 620<br />
Der Eid war in verschiedenen Lebenslagen zu leisten. Es wird zwischen dem<br />
gelobenden Eid 621 und dem bekundenden, verpflichtenden Eid 622 unterschieden.<br />
Der Eid war ein etwa von Zeugen, von Angeschuldigten, aber auch von den verschiedenen<br />
Pflichtenträgern des Staatswesens feierlich <strong>aus</strong>gesprochenes Versprechen<br />
<strong>gegen</strong>über dem Staatswesen und der Obrigkeit, gleichzeitig eine Bindung<br />
an Gott und eine Unterwerfung unter seine Gebote und Verbote. 623 Das<br />
Landmandat von 1761 beispielsweise kannte explizit den «Amman- und Richter<br />
Aydt», der diese Amtsträger verpflichtete, ihre Arbeit rechtsgleich, unbestechlich,<br />
unparteiisch und «umb des blossen Rechten willen, alles getreulich und<br />
ungefährde» <strong>aus</strong>zuführen. 624<br />
Einen Eid leisten mussten auch die Pfalzräte in der Fürstabtei. Das Konzept<br />
der Pfalzratsordnung 1733 erinnert die Pfalzräte daran, dass sie in allen Rechts-<br />
618<br />
619<br />
620<br />
621<br />
622<br />
623<br />
624<br />
FUCHS, Gott [2000], S. 326, ferner S. 323.<br />
Die im 18. Jahrhundert lauter werdenden Forderungen nach Toleranz stellten den Eid als<br />
religiös fundiertes Zwangsmittel allmählich in Frage. Schliesslich erklärte etwa der Philosoph<br />
Immanuel Kant (geb. 1724, gest. 1804) den Eid als mit der menschlichen Freiheit<br />
unvereinbar. Insbesondere nach 1800 verlangten Kritiker wenn nicht die vollständige Abschaffung<br />
des Eids, so doch seine Umwandlung in einen vernunftrechtlich begründeten,<br />
auf der Pflicht zur Wahrhaftigkeit beruhenden «bürgerlichen» Eid; LUMINATI, Eidverweigerung<br />
[2008], S. 204.<br />
LUMINATI, Eid, Kap. 2, e-HLS [2005].<br />
Der gelobende Eid nimmt die Form eines Treueschwurs an und gründet bzw. festigt<br />
Rechtsverhältnisse verschiedenster Art; MUNZEL-EVERLING [2007], Sp. 1250 ff.<br />
Der bekundende Eid ist etwa der Reinigungseid im Beweisrecht; MUNZEL-EVERLING<br />
[2007], Sp. 1253.<br />
ZIEGLER STEPHAN [1997], S. 23; SCHMIDT HANS-JOACHIM [2006], S. 84. Eine (<strong>aus</strong>nahmsweise)<br />
ein Amt bekleidende Frau durfte oftmals keinen Eid schwören, sondern nur<br />
ein Gelübde ablegen. In der Fürstabtei St. Gallen mussten alle männlichen Untertanen einen<br />
allgemeinen Eid zu Gehorsam, Treue und Wahrheit <strong>gegen</strong>über dem Abt schwören,<br />
vgl. Anhang zum Landmandat 1761, RQSG (Alte Landschaft), S. 147 f.<br />
Anhang zum Landmandat 1761, RQSG (Alte Landschaft), S. 148. Der Anhang kennt<br />
weiter den «Ammann-, Weibel- und Würthen-Aydt».<br />
117