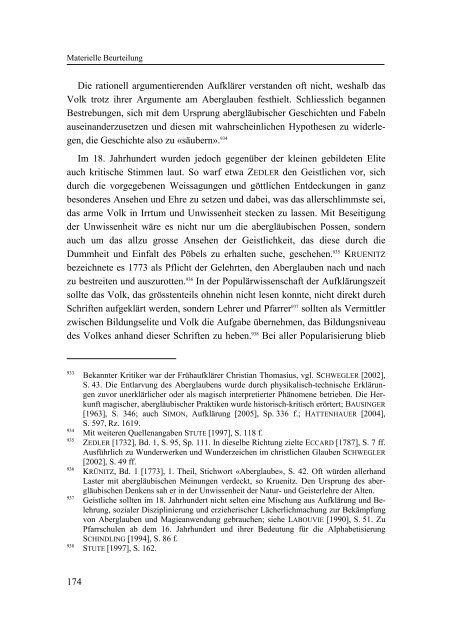Pfalzrätliche Strafuntersuchung gegen Joseph Antoni Egger aus ...
Pfalzrätliche Strafuntersuchung gegen Joseph Antoni Egger aus ...
Pfalzrätliche Strafuntersuchung gegen Joseph Antoni Egger aus ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Materielle Beurteilung<br />
Die rationell argumentierenden Aufklärer verstanden oft nicht, weshalb das<br />
Volk trotz ihrer Argumente am Aberglauben festhielt. Schliesslich begannen<br />
Bestrebungen, sich mit dem Ursprung abergläubischer Geschichten und Fabeln<br />
<strong>aus</strong>einanderzusetzen und diesen mit wahrscheinlichen Hypothesen zu widerlegen,<br />
die Geschichte also zu «säubern». 934<br />
Im 18. Jahrhundert wurden jedoch <strong>gegen</strong>über der kleinen gebildeten Elite<br />
auch kritische Stimmen laut. So warf etwa ZEDLER den Geistlichen vor, sich<br />
durch die vorgegebenen Weissagungen und göttlichen Entdeckungen in ganz<br />
besonderes Ansehen und Ehre zu setzen und dabei, was das allerschlimmste sei,<br />
das arme Volk in Irrtum und Unwissenheit stecken zu lassen. Mit Beseitigung<br />
der Unwissenheit wäre es nicht nur um die abergläubischen Possen, sondern<br />
auch um das allzu grosse Ansehen der Geistlichkeit, das diese durch die<br />
Dummheit und Einfalt des Pöbels zu erhalten suche, geschehen. 935 KRUENITZ<br />
bezeichnete es 1773 als Pflicht der Gelehrten, den Aberglauben nach und nach<br />
zu bestreiten und <strong>aus</strong>zurotten. 936 In der Populärwissenschaft der Aufklärungszeit<br />
sollte das Volk, das grösstenteils ohnehin nicht lesen konnte, nicht direkt durch<br />
Schriften aufgeklärt werden, sondern Lehrer und Pfarrer 937 sollten als Vermittler<br />
zwischen Bildungselite und Volk die Aufgabe übernehmen, das Bildungsniveau<br />
des Volkes anhand dieser Schriften zu heben. 938 Bei aller Popularisierung blieb<br />
933<br />
934<br />
935<br />
936<br />
937<br />
938<br />
Bekannter Kritiker war der Frühaufklärer Christian Thomasius, vgl. SCHWEGLER [2002],<br />
S. 43. Die Entlarvung des Aberglaubens wurde durch physikalisch-technische Erklärungen<br />
zuvor unerklärlicher oder als magisch interpretierter Phänomene betrieben. Die Herkunft<br />
magischer, abergläubischer Praktiken wurde historisch-kritisch erörtert; BAUSINGER<br />
[1963], S. 346; auch SIMON, Aufklärung [2005], Sp. 336 f.; HATTENHAUER [2004],<br />
S. 597, Rz. 1619.<br />
Mit weiteren Quellenangaben STUTE [1997], S. 118 f.<br />
ZEDLER [1732], Bd. 1, S. 95, Sp. 111. In dieselbe Richtung zielte ECCARD [1787], S. 7 ff.<br />
Ausführlich zu Wunderwerken und Wunderzeichen im christlichen Glauben SCHWEGLER<br />
[2002], S. 49 ff.<br />
KRÜNITZ, Bd. 1 [1773], 1. Theil, Stichwort «Aberglaube», S. 42. Oft würden allerhand<br />
Laster mit abergläubischen Meinungen verdeckt, so Kruenitz. Den Ursprung des abergläubischen<br />
Denkens sah er in der Unwissenheit der Natur- und Geisterlehre der Alten.<br />
Geistliche sollten im 18. Jahrhundert nicht selten eine Mischung <strong>aus</strong> Aufklärung und Belehrung,<br />
sozialer Disziplinierung und erzieherischer Lächerlichmachung zur Bekämpfung<br />
von Aberglauben und Magieanwendung gebrauchen; siehe LABOUVIE [1990], S. 51. Zu<br />
Pfarrschulen ab dem 16. Jahrhundert und ihrer Bedeutung für die Alphabetisierung<br />
SCHINDLING [1994], S. 86 f.<br />
STUTE [1997], S. 162.<br />
174