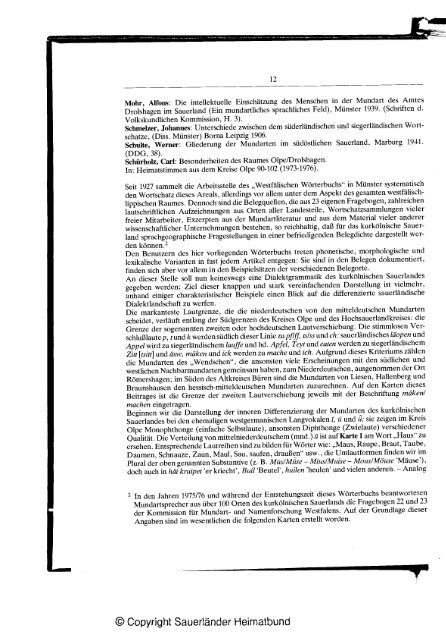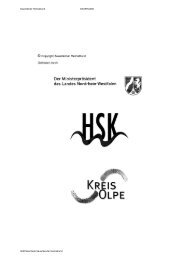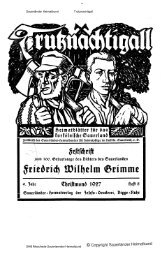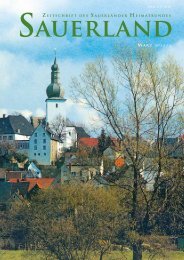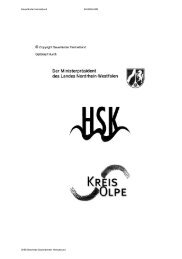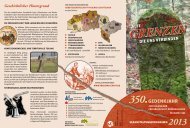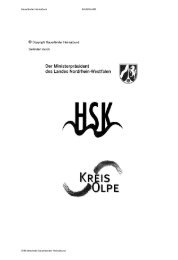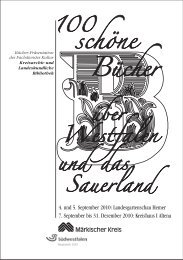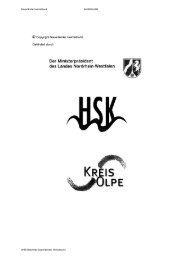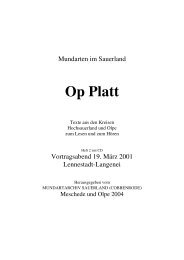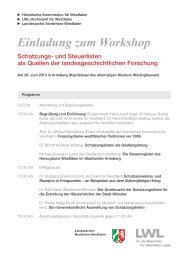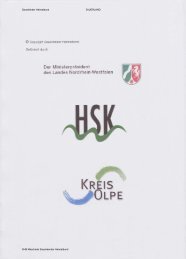Plattdeutsches Wörterbuch des kurkölnischen Sauerlandes
Plattdeutsches Wörterbuch des kurkölnischen Sauerlandes
Plattdeutsches Wörterbuch des kurkölnischen Sauerlandes
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12<br />
msa<br />
Mohr, Alfons: Die intellektuelle Einschätzung <strong>des</strong> Menschen in der Mundart <strong>des</strong> Amtes<br />
Drolshagen im Sauerland (Ein mundartliches sprachliches Feld), Münster 1939. (Schriften d.<br />
Volkskundlichen Kommission, H. 3).<br />
Schmelzer, Johannes: Unterschiede zwischen dem süderländischen und siegerländischen Wort-<br />
schatze, (Diss. Münster) Borna Leipzig 1906.<br />
Schulte, Werner: Gliederung der Mundarten im südöstlichen Sauerland, Marburg 1941.<br />
(DDG, 38).<br />
Schürholz, Carl: Besonderheiten <strong>des</strong> Raumes Olpe/Drolshagen.<br />
In: Heimatstimmen aus dem Kreise Olpe 90-102 (1973-1976).<br />
Seit 1927 sammelt die Arbeitsstelle <strong>des</strong> „WestfäUschen <strong>Wörterbuch</strong>s" in Münster systematisch<br />
den Wortschatz dieses Areals, allerdings vor allem unter dem Aspekt <strong>des</strong> gesamten westfäUsch-<br />
lippischen Raumes. Dennoch sind die Belegquellen, die aus 23 eigenen Fragebogen, zahlreichen<br />
lautschriftlichen Aufzeichnungen aus Orten aller Lan<strong>des</strong>teile, Wortschatzsammlungen vieler<br />
freier Mitarbeiter, Exzerpten aus der Mundartliteratur und aus dem Material vieler anderer<br />
wissenschaftlicher Unternehmungen bestehen, so reichhaltig, daß für das kurkölnische Sauer-<br />
land sprachgeographische Fragestellungen in einer befriedigenden Belegdichte dargestellt wer-<br />
den können.^<br />
Den Benutzem <strong>des</strong> hier voriiegenden <strong>Wörterbuch</strong>s treten phonetische, morphologische und<br />
lexikalische Varianten in fast jedem Artikel entgegen: Sie sind in den Belegen dokumentiert,<br />
finden sich aber vor allem in den Beispielsätzen der verschiedenen Belegorte.<br />
An dieser Stelle soll nun keineswegs eine Dialektgrammatik <strong>des</strong> <strong>kurkölnischen</strong> Sauerian<strong>des</strong><br />
gegeben werden; Ziel dieser knappen und stark vereinfachenden Darstellung ist vielmehr,<br />
anhand einiger charakteristischer Beispiele einen Blick auf die differenzierte saueriändische<br />
Dialektlandschaft zu werfen.<br />
Die markanteste Lautgrenze, die die niederdeutschen von den mitteldeutschen Mundarten<br />
scheidet, veriäuft entlang der Südgrenzen <strong>des</strong> Kreises Olpe und <strong>des</strong> Hochsaueriandkreises: die<br />
Grenze der sogenannten zweiten oder hochdeutschen Lautverschiebung. Die stimmlosen Ver-<br />
schlußlaute p, «und k werden südlich dieser Linie zupf/ff, ts/ss und ch: saueriändisches läopen und<br />
Appel wird zu siegerländischem lauffe und hd. Apfel, Teyt und eaten werden zu siegeriändischem<br />
Zitt [tsitt] und ässe, mäken und ick werden zu mache und ich. Aufgrund dieses Kriteriums zählen<br />
die Mundarten <strong>des</strong> „Wendschen", die ansonsten viele Erscheinungen mit den südlichen und<br />
westlichen Nachbarmundarten gemeinsam haben, zum Niederdeutschen, ausgenommen der Ort<br />
Römershagen; im Süden <strong>des</strong> Altkreises Buren sind die Mundarten von Liesen, Hallenberg und<br />
Braunshausen den hessisch-mitteldeutschen Mundarten zuzurechnen. Auf den Karten dieses<br />
Beitrages ist die Grenze der zweiten Lautverschiebung jeweils mit der Beschriftung mäkenl<br />
machen eingetragen.<br />
Beginnen wir die Darstellung der inneren Differenzierung der Mundarten <strong>des</strong> <strong>kurkölnischen</strong><br />
Sauerian<strong>des</strong> bei den ehemaligen westgermanischen Langvokalen l, ü und ü; sie zeigen im Kreis<br />
Olpe Monophthonge (einfache Selbstlaute), ansonsten Diphthonge (Zwielaute) verschiedener<br />
Qualität. Die Verteilung von mittelniederdeutschem (mnd.) ü ist auf Karte 1 am Wort „Haus" zu<br />
ersehen. Entsprechende Lautreihen sind zu bilden für Wörter wie: „Maus, Raupe, Braut, Taube,<br />
Daumen, Schnauze, Zaun, Maul, Sau, saufen, draußen" usw., die Umlautformen finden wir im<br />
Plural der oben genannten Substantive (z. B. Müs/Müse - MiusIMuise - MouslMöuse 'Mäuse'),<br />
doch auch in häi kmipet 'er kriecht', Buil 'Beutel', huilen 'heulen' und vielen anderen. - Analog<br />
2 In den Jahren 1975/76 und während der Entstehungszeit dieses <strong>Wörterbuch</strong>s beantworteten<br />
Mundartsprecher aus über 100 Orten <strong>des</strong> <strong>kurkölnischen</strong> Saueriands die Fragebogen 22 und 23<br />
der Kommission für Mundart- und Namenforschung Westfalens. Auf der Grundlage dieser<br />
Angaben sind im wesenthchen die folgenden Karten erstellt worden.<br />
© Copyright Sauerländer Heimatbund