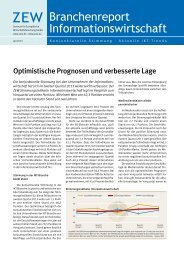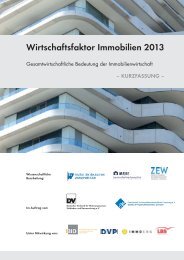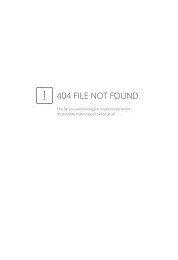Geburten und Kinderwünsche in Deutschland
Geburten und Kinderwünsche in Deutschland
Geburten und Kinderwünsche in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Geburten</strong> <strong>und</strong> <strong>K<strong>in</strong>derwünsche</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong>:<br />
Bestandsaufnahme, E<strong>in</strong>flussfaktoren <strong>und</strong> Datenquellen<br />
renzen der Partner bezüglich <strong>K<strong>in</strong>derwünsche</strong>n <strong>und</strong> hat die Frau e<strong>in</strong>en höheren<br />
K<strong>in</strong>derwunsch als der Mann, ist sie qua ihrer starken Verhandlungsposition <strong>in</strong><br />
der Lage, diesen K<strong>in</strong>derwunsch durchzusetzen; hat die Frau die niedrigere Präferenz<br />
für K<strong>in</strong>der, kann sie auch diese durchsetzen (Hener 2010, Iyigun <strong>und</strong><br />
Walsh 2007): Hat die Frau aufgr<strong>und</strong> vorhergesehener Spezialisierungsrisiken,<br />
die von ihrem Rückzug vom Arbeitsmarkt langfristig ausgehen, e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere<br />
Präferenz für K<strong>in</strong>der als der Mann, kann sie bei starker E<strong>in</strong>kommensposition<br />
den Verzicht auf K<strong>in</strong>der durchsetzen, sodass e<strong>in</strong>e aus Haushalts- wie gesellschaftlicher<br />
Sicht suboptimale <strong>Geburten</strong>zahl resultiert (Rasul 2008). Die<br />
‚power rule‘ <strong>in</strong> Verhandlungsmodellen bietet daher e<strong>in</strong>en alternativen Erklärungsansatz<br />
für <strong>Geburten</strong>effekte hoher weiblicher Lohnraten <strong>und</strong> das Phänomen<br />
der K<strong>in</strong>derlosigkeit von Akademiker<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Kontexten mit eher ger<strong>in</strong>ger<br />
Vere<strong>in</strong>barkeit von Familie <strong>und</strong> Beruf.<br />
5.1.5.6 Lebense<strong>in</strong>kommensprofil des weiblichen Partners<br />
Da K<strong>in</strong>der e<strong>in</strong>e „lebenslange Unternehmung“ s<strong>in</strong>d, wie Gustafsson (2003: 353)<br />
treffend bemerkt, ist es nötig, bei der Betrachtung von Opportunitätskosten<br />
nicht nur das entgangene laufende E<strong>in</strong>kommen, sondern das entgangene Lebense<strong>in</strong>kommen<br />
<strong>in</strong> den Blick zu nehmen. So führen etwa Dey <strong>und</strong> Wasoff<br />
(2010) die von ihnen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Stichprobe schottischer Eltern beobachtete Differenz<br />
zwischen ‚idealer‘ <strong>und</strong> tatsächlicher K<strong>in</strong>derzahl auf e<strong>in</strong>e Verzögerung<br />
erster <strong>Geburten</strong> zurück, die aus „opportunity costs of childbear<strong>in</strong>g <strong>in</strong> terms of<br />
foregone qualifications, careers and earn<strong>in</strong>gs“ resultiert.<br />
Der E<strong>in</strong>fluss von <strong>Geburten</strong> auf den weiteren Karriere- <strong>und</strong> E<strong>in</strong>kommenspfad<br />
von Frauen ist mittlerweile Gegenstand zahlreicher ökonomischer Analysen<br />
der Fertilität (M<strong>in</strong>cer <strong>und</strong> Polachek 1974, Happel et al. 1984, Wolp<strong>in</strong> 1984,<br />
Moffitt 1984, Cigno <strong>und</strong> Ermisch 1989, Hotz <strong>und</strong> Miller 1988; 1993, Joshi 1990;<br />
1998, Cigno 1991, Walker 1995, Dankmeyer 1996, Gustafsson 2003, Hotz<br />
2007, Erosa et al. 2010). Die Opportunitätskosten der K<strong>in</strong>derbetreuungszeit<br />
variieren dabei nicht nur über die Person, sondern auch über die Zeit, woraus<br />
sich unmittelbar Tim<strong>in</strong>g-Effekte ergeben. Im E<strong>in</strong>zelnen s<strong>in</strong>d fünf Faktoren<br />
maßgeblich: Der vorgeburtliche Humankapitalstock der Frau (vgl. die Ausführungen<br />
zum Bildungseffekt weiter oben), der Grad der Entwertung des Humankapitals<br />
während der Auszeitphase (Happel et al. 1984, ferner M<strong>in</strong>cer <strong>und</strong><br />
Polachek 1974 sowie Erosa et al. 2010), die Dauer der Auszeitphase (Walker<br />
90