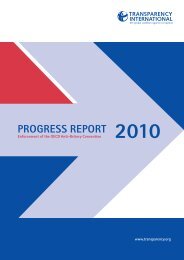17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ges<strong>und</strong>heit<br />
soll allerdings nur möglich sein, wenn zeitgleich eine Ärztin oder ein Arzt,<br />
eine Apothekerin oder ein Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf<br />
tätige Person mit dem gleichfalls elektronischen so genannten Heilberufsausweis<br />
(HPC) das System bedient. Dadurch sollen die Missbrauchsmöglichkeiten<br />
der Karte verringert werden beispielsweise bei Verlust oder<br />
Diebstahl.<br />
Das Gesetz schreibt vor, dass als Pflichtdaten <strong>und</strong> -funktionalitäten auf<br />
der Karte neben den formellen Versicherungsvertragsdaten, dem<br />
Berechtigungsnachweis E 111 (zur Inanspruchnahme von Leistungen im<br />
europäischen Ausland) sowie einem Lichtbild <strong>und</strong> der Unterschrift der<br />
Karteninhaberin oder des Karteninhabers auch Angaben zum so genannten<br />
elektronischen Rezept (e-Rezept) enthalten sind.<br />
Es gibt aber keinen Zwang, darüber hinaus gehende Angaben auf der Karte<br />
zu speichern. Die übrigen gesetzlich vorgesehenen Anwendungen der Karte<br />
sind freiwillige Nutzungsmöglichkeiten (dazu zählen die elektronische<br />
Patientenakte, der elektronische Arztbrief, die Arzneimitteldokumentation,<br />
von den Versicherten selbst zur Verfügung gestellte Daten sowie<br />
Kostenaufstellungen). Hier ist noch ungeregelt, wie diese technisch zu<br />
konzipieren sind, um den Benutzerinnen <strong>und</strong> Benutzern die größtmögliche<br />
Souveränität über ihre eigenen Daten zu gewähren <strong>und</strong> die Erstellung von<br />
Profilen zu vermeiden. Erforderlich sind auch gestaffelte Zugriffsrechte.<br />
Diese könnten mit PINs <strong>und</strong> TANs – ähnlich wie beim Online-Banking –<br />
geschützt werden. Damit ergibt sich jedoch das Problem, dass diejenigen<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, die nicht so vertraut mit technischen Neuerungen<br />
sind, mit den neuen Funktionen nicht so umgehen können, dass sie ihr Recht<br />
auf informationelle Selbstbestimmung nicht doch aus der Hand geben, weil<br />
sie auf die Mithilfe einer dritten Person beim Bedienen der Karte<br />
angewiesen sind.<br />
Zur Verwendung von Chipkarten im Ges<strong>und</strong>heitswesen wurden schon im<br />
13. <strong>Datenschutz</strong>bericht 1995/96 unter 12.1, S. 88 ff., die gr<strong>und</strong>legend zu<br />
beachtenden Anforderungen dargestellt. Auch die Entschließung der<br />
Konferenz der <strong>Datenschutz</strong>beauftragten des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der Länder vom<br />
25./26. September 2003 zum Ges<strong>und</strong>heitsmodernisierungsgesetz (Abdruck<br />
im Anhang, Nr. 12) nimmt dazu Stellung. Diese Forderungen haben nichts<br />
von ihrer Aktualität verloren.<br />
Der Arbeitskreis „Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Soziales“ der <strong>Datenschutz</strong>beauftragten<br />
des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der Länder hat eine Unterarbeitsgruppe „Ges<strong>und</strong>heitskarte“<br />
118<br />
LDI NRW <strong>17.</strong> <strong>Datenschutz</strong>bericht 2005