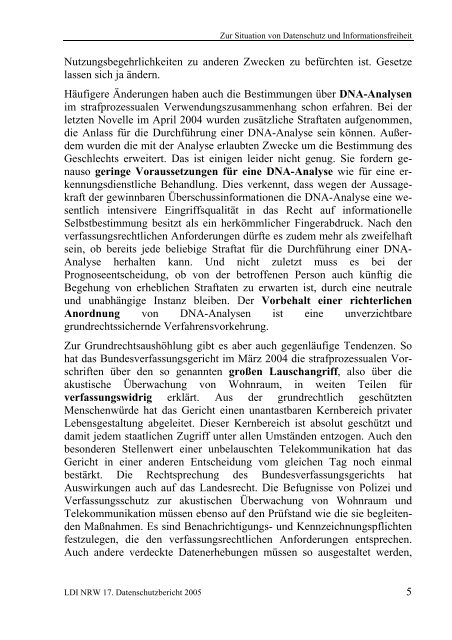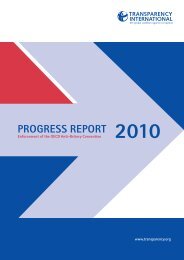17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zur Situation von <strong>Datenschutz</strong> <strong>und</strong> Informationsfreiheit<br />
Nutzungsbegehrlichkeiten zu anderen Zwecken zu befürchten ist. Gesetze<br />
lassen sich ja ändern.<br />
Häufigere Änderungen haben auch die Bestimmungen über DNA-Analysen<br />
im strafprozessualen Verwendungszusammenhang schon erfahren. Bei der<br />
letzten Novelle im April 2004 wurden zusätzliche Straftaten aufgenommen,<br />
die Anlass für die Durchführung einer DNA-Analyse sein können. Außerdem<br />
wurden die mit der Analyse erlaubten Zwecke um die Bestimmung des<br />
Geschlechts erweitert. Das ist einigen leider nicht genug. Sie fordern genauso<br />
geringe Voraussetzungen für eine DNA-Analyse wie für eine erkennungsdienstliche<br />
Behandlung. Dies verkennt, dass wegen der Aussagekraft<br />
der gewinnbaren Überschussinformationen die DNA-Analyse eine wesentlich<br />
intensivere Eingriffsqualität in das Recht auf informationelle<br />
Selbstbestimmung besitzt als ein herkömmlicher Fingerabdruck. Nach den<br />
verfassungsrechtlichen Anforderungen dürfte es zudem mehr als zweifelhaft<br />
sein, ob bereits jede beliebige Straftat für die Durchführung einer DNA-<br />
Analyse herhalten kann. Und nicht zuletzt muss es bei der<br />
Prognoseentscheidung, ob von der betroffenen Person auch künftig die<br />
Begehung von erheblichen Straftaten zu erwarten ist, durch eine neutrale<br />
<strong>und</strong> unabhängige Instanz bleiben. Der Vorbehalt einer richterlichen<br />
Anordnung von DNA-Analysen ist eine unverzichtbare<br />
gr<strong>und</strong>rechtssichernde Verfahrensvorkehrung.<br />
Zur Gr<strong>und</strong>rechtsaushöhlung gibt es aber auch gegenläufige Tendenzen. So<br />
hat das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht im März 2004 die strafprozessualen Vorschriften<br />
über den so genannten großen Lauschangriff, also über die<br />
akustische Überwachung von Wohnraum, in weiten Teilen für<br />
verfassungswidrig erklärt. Aus der gr<strong>und</strong>rechtlich geschützten<br />
Menschenwürde hat das Gericht einen unantastbaren Kernbereich privater<br />
Lebensgestaltung abgeleitet. Dieser Kernbereich ist absolut geschützt <strong>und</strong><br />
damit jedem staatlichen Zugriff unter allen Umständen entzogen. Auch den<br />
besonderen Stellenwert einer unbelauschten Telekommunikation hat das<br />
Gericht in einer anderen Entscheidung vom gleichen Tag noch einmal<br />
bestärkt. Die Rechtsprechung des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts hat<br />
Auswirkungen auch auf das Landesrecht. Die Befugnisse von Polizei <strong>und</strong><br />
Verfassungsschutz zur akustischen Überwachung von Wohnraum <strong>und</strong><br />
Telekommunikation müssen ebenso auf den Prüfstand wie die sie begleitenden<br />
Maßnahmen. Es sind Benachrichtigungs- <strong>und</strong> Kennzeichnungspflichten<br />
festzulegen, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechen.<br />
Auch andere verdeckte Datenerhebungen müssen so ausgestaltet werden,<br />
LDI NRW <strong>17.</strong> <strong>Datenschutz</strong>bericht 2005 5