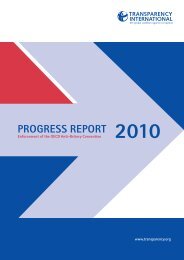17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
17. Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Justiz<br />
Hautpartikeln. In weitaus höherem Maß als bei Fingerabdrücken besteht<br />
deshalb die Gefahr, dass genetisches Material einer Nichttäterin oder eines<br />
Nichttäters – zufällig oder bewusst – an Tatorten, beispielsweise durch eine<br />
nicht wahrnehmbare Kontamination mit Zwischenträgern oder durch bewusste<br />
Manipulation, platziert wird.<br />
Die <strong>Datenschutz</strong>beauftragen des B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> der Länder fordern deshalb in<br />
ihrer Entschließung vom 16. Juli 2003 (Abdruck im Anhang, Nr. 10), dass<br />
die DNA-Analyse nicht zu einem alltäglichen Routinewerkzeug jeder<br />
erkennungsdienstlichen Behandlung werden darf <strong>und</strong> an dem bestehenden<br />
Vorbehalt einer richterlichen Anordnung für die Untersuchung von<br />
Körperzellen festgehalten wird.<br />
9.3 Telefonverbindungsdaten ohne richterliche Anordnung – die<br />
Spitze eines Eisbergs?<br />
Anlässlich eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen einen<br />
Journalisten verlangte die Staatsanwaltschaft ohne richterliche<br />
Anordnung von einem Ministerium die Herausgabe von Telefondaten.<br />
Für einen bestimmten Zeitraum sollte vorgelegt werden, mit welchen<br />
Personen die dort Beschäftigten wann telefoniert hatten.<br />
Zunächst wurde pauschal um die Übermittlung derjenigen gespeicherten<br />
Telekommunikationsverbindungsdaten gebeten, die in einer bestimmten<br />
Kalenderwoche angefallen waren. Dieses Ansinnen wurde nach<br />
kontroversem Schriftwechsel auf die dienstlich geführten Gespräche<br />
beschränkt. Eine gesetzliche Gr<strong>und</strong>lage dafür gibt es jedoch nicht – weder<br />
für die eine noch für die andere Maßnahme.<br />
In öffentlichen Stellen ist es gängige Praxis, die Nutzung der Telefone nicht<br />
nur für dienstliche Gespräche, sondern ebenfalls für Privatgespräche zu<br />
gestatten. Privatgespräche müssen aber auch privat bezahlt werden. Um eine<br />
korrekte Abrechnung zu ermöglichen, werden die Privatgespräche nach<br />
Dauer <strong>und</strong> Kosten erfasst. Dabei wird auch die angewählte Rufnummer gespeichert,<br />
allerdings in aller Regel verkürzt um die letzten zwei oder drei<br />
Ziffern. Damit wird dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses der Beschäftigten<br />
Rechnung getragen, ihnen aber auch zugleich ermöglicht, nachzuvollziehen,<br />
ob sie die betreffenden Gespräche tatsächlich geführt haben. Werden<br />
in öffentlichen Stellen Telekommunikationsanlagen nicht nur für die ausschließlich<br />
dienstliche, sondern auch für die private Nutzung zur Verfügung<br />
gestellt, so wird der Dienstherr im Bereich der erlaubten Privatnutzung im<br />
88<br />
LDI NRW <strong>17.</strong> <strong>Datenschutz</strong>bericht 2005