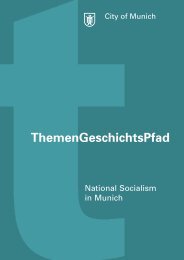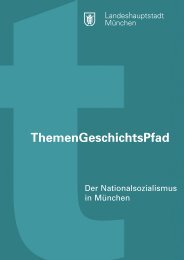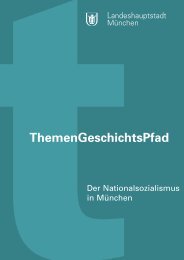Similar
Similar
Similar
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1938 erhielt sie von einer Klientin Frau Levy den Auftrag, ein Grabmal für ihren verstorbenen<br />
Mann zu schaffen. Für die jüdische Frau brachte sie ihr Mitgefühl zum Ausdruck:<br />
„Ich habe wiederholt an sie gedacht, liebe Frau Levy, nicht nur zur Grabstätte gingen die<br />
Gedanken, sondern zu Ihnen. Glauben Sie mir, wir litten alle gemeinsam tief. Schmerz und<br />
Scham fühlen wir. Und Empörung.“ 311<br />
Mit dem Künstler Ernst Barlach verband Kollwitz eine enge Freundschaft. Von ihm erhielt<br />
sie Anregungen zu eigenen Holzschnitten und bildhauerischen Arbeiten. Barlach<br />
(1870–1938) hat Käthe Kollwitz mit seiner schwebenden Figur im Güstrower Dom ein<br />
Denkmal gesetzt, diese trägt die Gesichtszüge der Künstlerin. Als Barlach im Oktober<br />
1938 starb, verfasste Käthe Kollwitz einen Nachruf: „... worauf der starke Eindruck beruht,<br />
den Barlachs Arbeiten von jeher auf mich machen, so glaube ich, ist es dies, wie er<br />
selbst einmal formuliert hat: ,es ist außen wie innen ... – Seine Arbeit ist außen wie innen,<br />
Form und Inhalt decken sich aufs genaueste.“ 312<br />
Ihr Ehemann, Dr. Karl Kollwitz, der aus gesundheitlichen Gründen seine Praxis aufgab,<br />
starb nach langer Krankheit am 19. Juli 1940. Käthe Kollwitz, 73-jährig, musste ihr Atelier<br />
in der Klosterstraße aufgeben und verlagerte es in ihre Wohnung in die Weißenburger Straße<br />
24 (heute Kollwitzstraße). Die Rekrutierung Minderjähriger zum „Volkssturm“ kommentierte<br />
die Künstlerin nun mit dem Werk Saatfrüchte sollen nicht zermalen werden. Wegen<br />
der immer häufigeren Bombenangriffe auf Berlin zog Käthe Kollwitz zur Bildhauerin Margret<br />
Böning nach Nordhausen. Die 78-jährige musste ihre Wohnung, in der sie über 50 Jahre<br />
gelebt hatte, verlassen. Eine Bombe zerstörte das Haus; viele Bilder und Druckwerke der<br />
Künstlerin wurden dabei vernichtet. Ein weiterer Umzug wurde im Juli 1944 nötig, da Nordhausen<br />
ebenfalls nicht mehr sicher schien. Durch Vermittlung des Prinzen Ernst Heinrich<br />
von Sachsen übersiedelte sie auf den „Rüdenhof“ in Moritzburg bei Dresden.<br />
Dort starb Käthe Kollwitz am 22. April 1945, 78-jährig. Vorerst wurde sie in Moritzburg<br />
beerdigt; später kam ihre Urne in das Familiengrab auf den Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfeld.<br />
Dort steht auf dem von ihr selbst geschaffenen Grabrelief, an dem sie seit 1935/<br />
36 gearbeitet hatte, das Goethe-Zitat: „Ruht im Frieden seiner Hände“. In ihrem Tagebuch<br />
schrieb Käthe Kollwitz: „Aus niedergedrückter Stimmung und dem Gefühl, doch<br />
nichts mehr zu sagen zu haben in meiner Arbeit, tauchte wieder der frühere Wunsch auf,<br />
ein Relief für unser Grab zu machen. Nun hab ich es begonnen. Ich bin eigentlich verwundert<br />
darüber, daß die Grabmalkunst so gar nicht gepflegt wird. Man bracht nur einmal<br />
anzufangen, sich damit beschäftigen, so strömen einem geradezu die Motive entgegen.“ 313<br />
311 Kollwitz, Käthe (1966): Briefe der Freundschaft: 86. In: Krahmer Catherine (1986): Käthe Kollwitz: 122<br />
312 Jansen, Elmar: Auguste Rodin: 52. In: Krahmer, Catherine (1986): Käthe Kollwitz: 123<br />
313 Krahmer, Catherine (1986): Käthe Kollwitz: 121<br />
150