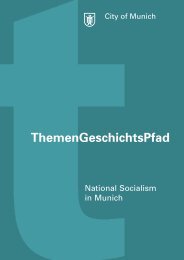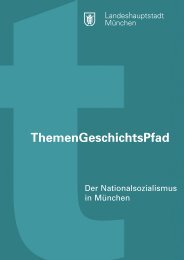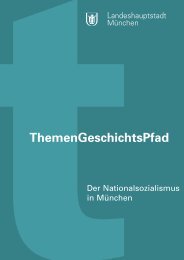Similar
Similar
Similar
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
so nicht genutzt werden, „denn er war Zeuge vom Ein- und Ausgehen hilfloser, todahnender<br />
Menschen. Der Durchgang wird von einem vorgestellten Granitblock unpassierbar<br />
gemacht.“ Der durch den Block verlaufende „Hohlraum läßt somit eine Verbindung vom<br />
Steinblock zum freistehenden Portal erkennen“. 160<br />
GESCHICHTLICHER HINTERGRUND UND DEUTUNG<br />
Nach der seit dem Frühjahr 1941 bestehenden „Judensiedlung Milbertshofen“ wurde im<br />
Juli desselben Jahres im Klosterbau der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz und<br />
Hl. Paul in Berg am Laim, St. Michael-Straße 16, auf zwei Etagen eine so genannte „Heimanlage<br />
für Juden“ eingerichtet. In 38 Zimmern konnten 275 bis 300 Personen untergebracht<br />
werden. Am 31. Dezember 1941 betrug die Belegzahl in der „Heimanlage“ 222<br />
Personen. 161 Die Kosten für Unterbringung und Verpflegung hatten die Insassen selbst zu<br />
tragen, für die Ausstattung musste die Israelitische Gemeinde München aufkommen. Else<br />
Behrend-Rosenfeld, die zuvor zur Zwangsarbeit in einer Flachsfabrik in Lohhof verpflichtet<br />
war, übernahm im Auftrag der Israelitischen Kultusgemeinde die Wirtschaftsführung<br />
des Heimes. Obwohl den Klosterschwestern von der Gestapo, die das Heim kontrollierte,<br />
jeder Kontakt mit den neuen Bewohnern untersagt war, zeichneten sie sich durch Hilfsbereitschaft<br />
und Solidarität den verfolgten Menschen gegenüber aus. „Wir alle sind hier<br />
draußen wie von einem Druck befreit, der in der Stadt ständig auf uns lag ... die stets gleichen<br />
freundlichen Gesichter der Nonnen, ... und das wohlwollende Bewußtsein, von ihnen<br />
nicht gehaßt und verachtet, sondern mit schwesterlicher Zuneigung betrachtet zu werden,<br />
bedeutet eine große Entlastung“ 162 , so schrieb Else Behrend-Rosenfeld. Doch weiterer<br />
Zuzug bis zur Vollbelegung mit 320 Personen und immer neue Repressalien erschwerten<br />
die Lebensumstände erheblich. „Wir bekamen Bescheid, daß von jedem Insassen pro Tag<br />
fünfzig Pfennig für das Wohnen zu zahlen seien. ... Das ganze Mietgeld muß jeden Freitag<br />
mit der genauen Aufstellung der Insassenzahl in die Widenmayerstraße gebracht werden,<br />
zusammen mit dem Küchenzettel für die kommende Woche, den ich zu machen habe.“ 163<br />
Am 6. November 1941 setzten die Vorbereitungen für die ersten Transporte von deutschen<br />
Juden nach Riga, Minsk und Kowno ein; sie führten direkt in den Tod. Vom ersten Transport<br />
von München aus, am 20. November 1941 mit 999 Personen nach Riga 164 , gab es keine<br />
Überlebenden. „– Und von keinem von allen, die deportiert wurden, ist je wieder eine<br />
Nachricht gekommen,“ bezeugte Else Behrend-Rosenfeld, die viele persönliche Schick-<br />
160 Brief vom 11.5.1986 an das Städt. Baureferat, Hochbau I der Landeshauptstadt München.<br />
161 Dokument: 20. Zitiert in: Stadtarchiv München (Hrsg.) (2000): „... verzogen, unbekannt wohin“, o. S.<br />
162 Behrend-Rosenfeld, Else Dr. (1988): Ich stand nicht allein: 114<br />
163 Behrend-Rosenfeld, Else Dr. (1988): Ich stand nicht allein: 119<br />
164 Wegen Überfüllung des dortigen Ghettos wurde der Transport nach Kowno umgeleitet.<br />
81