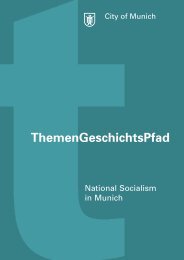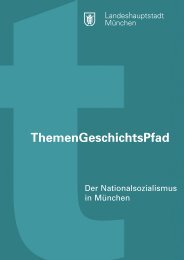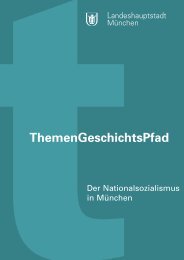- Seite 1 und 2:
3 Helga Pfoertner Mahnmale, Gedenks
- Seite 3 und 4:
Mahnmale, Gedenkstätten, Erinnerun
- Seite 5 und 6:
Dieses Werk ist Herrn Andreas Olsen
- Seite 7 und 8:
RSHA Reichsicherheitshauptamt SA St
- Seite 9 und 10:
Karl Leisner Seliger Neupriester 17
- Seite 11 und 12:
Israelitischer Friedhof - Alt Thalk
- Seite 13 und 14:
Nach der Pogromnacht am 9./10. Nove
- Seite 15 und 16:
Göppinger, Horst (1990): Juristen
- Seite 17 und 18:
Israelitischer Friedhof - Neu Garch
- Seite 19 und 20:
Mendle, Max *10.8.1873 Fischach (Kr
- Seite 21 und 22:
der Deportation retten. Obwohl Karl
- Seite 23 und 24:
Israelitisches Kranken- und Schwest
- Seite 25 und 26:
„Das Mahnmal bezieht seine intend
- Seite 27 und 28:
29 Judendeportation „... Am Güte
- Seite 29 und 30: INTENTION DER KÜNSTLERIN „Das Mo
- Seite 31 und 32: DEPORTATION DER MÜNCHNER JUDEN Am
- Seite 33 und 34: kam nach drei Tagen in Kowno an. 49
- Seite 35 und 36: Balbier, Elsa *21.2.1899 München
- Seite 37 und 38: 8. Februar - 26. Februar 1999: Und
- Seite 39 und 40: Rürup, Reinhard (1975): Emanzipati
- Seite 41 und 42: Gedenktafel Altes Rathaus, Altstadt
- Seite 43 und 44: von Einrichtungen und Ausraubung de
- Seite 45 und 46: „München - Hauptstadt der Bewegu
- Seite 47 und 48: Jüdisches Deportationslager Milber
- Seite 49 und 50: Einzelne Schicksale Carry Brachvoge
- Seite 51 und 52: 16 Menschen kamen in die „Heimanl
- Seite 53 und 54: Benz, Wolfgang (1990): Herrschaft u
- Seite 55 und 56: Jüdisches Kinderheim Antonienstra
- Seite 57 und 58: ösen Bereich liberalen jüdischen
- Seite 59 und 60: nathan Harris. Literatur Berger, Ma
- Seite 61 und 62: Jüdisches Museum München Reichenb
- Seite 63 und 64: Türe des Judentums“, Bildungs- u
- Seite 65 und 66: Beth ha - Knesseth, Ort der Zusamme
- Seite 67 und 68: Gedenktafel Prielmayerstraße 7, Ju
- Seite 69 und 70: keit und Laster symbolisieren. Im Z
- Seite 71 und 72: Dr. Otto Feldheim emigrierte im Apr
- Seite 73 und 74: und II und beim Oberlandesgericht M
- Seite 75 und 76: München. Silber emigrierte im Juni
- Seite 77 und 78: „Jüdisches Sammellager“ Berg a
- Seite 79: so nicht genutzt werden, „denn er
- Seite 83 und 84: Justizvollzugsanstalt München-Stad
- Seite 85 und 86: Zu IV. 1973: Erinnerungsort zur Hin
- Seite 87 und 88: mitgeteilt werden. Darauf folgte di
- Seite 89 und 90: Oleschinski, Brigitte (1995): Geden
- Seite 91 und 92: I. Gedenktafel, Fuchsstraße 2, Sch
- Seite 93 und 94: Kriegsbeginn war er 15 Jahre alt un
- Seite 95 und 96: ne Überzeugung von der Macht der E
- Seite 97 und 98: das NS-Regime geschrieben zu haben.
- Seite 99 und 100: 1968 Literaturpreis der Deutschen F
- Seite 101 und 102: 103 Kalter Haus, Tal 19 „... Ich
- Seite 103 und 104: GESCHICHTLICHER HINTERGRUND UND DEU
- Seite 105 und 106: Klee, Paul *18.12.1879 Münchenbuch
- Seite 107 und 108: Kandinsky studierte. Klee kehrte na
- Seite 109 und 110: der Künste. Diese hoffnungslose Si
- Seite 111 und 112: Deutsches Museum München (Hrsg.) (
- Seite 113 und 114: Grabmal von Walter Klingenbeck (Wal
- Seite 115 und 116: Zu II. Walter-Klingenbeck-Weg, Maxv
- Seite 117 und 118: NS-Regime in München. Konzipiert v
- Seite 119 und 120: I. Grabmal, Waldfriedhof Sektion 90
- Seite 121 und 122: tagsabgeordnete Toni Pfülf (siehe
- Seite 123 und 124: Britische und amerikanische Truppen
- Seite 125 und 126: nes seiner Hauptanliegen war eine u
- Seite 127 und 128: Tagung 6.-7. Juli 2001: Mobilisieru
- Seite 129 und 130: König, Lothar Prof. Dr. SJ *3.1.19
- Seite 131 und 132:
Literatur Bleistein, Roman (1982-19
- Seite 133 und 134:
I. Grabmal Friedhof St. Georg, Kirc
- Seite 135 und 136:
1905 erschien in der „Neuen Runds
- Seite 137 und 138:
Kolbs nächster Roman ist ihrer vie
- Seite 139 und 140:
sie die deutsch-französische Vers
- Seite 141 und 142:
Literatur Bauschinger, Sigrid (Hrsg
- Seite 143 und 144:
I. Städtisches Käthe-Kollwitz-Gym
- Seite 145 und 146:
Später erklärte sie, warum sie k
- Seite 147 und 148:
Gemeinsam mit Albert Einstein, Hein
- Seite 149 und 150:
Die große Spannweite des künstler
- Seite 151 und 152:
Bonus, Arthur (1925): Das Käthe-Ko
- Seite 153 und 154:
Mahnmal Durchgang im Alten Rathaus,
- Seite 155 und 156:
157 KZ Ehrenhain I „Die Zeit der
- Seite 157 und 158:
Die Asche der Toten stammt zumeist
- Seite 159 und 160:
KZ Ehrenhain II Friedhof Perlacher
- Seite 161 und 162:
Einzelne Schicksale: Famfulk, Frant
- Seite 163 und 164:
der zur kommunistischen Widerstands
- Seite 165 und 166:
I. Grabstätte Friedhof Perlacher F
- Seite 167 und 168:
Die zu Hause gepflegte Offenheit wu
- Seite 169 und 170:
Nachfolger gefunden hatte. Professo
- Seite 171 und 172:
Leisner, Karl Seliger Neupriester *
- Seite 173 und 174:
Die auf der rechten lautet: „Vikt
- Seite 175 und 176:
Seit Dezember 1940 zog man die in G
- Seite 177 und 178:
liebe. Liebe und Sühne! Ich danke
- Seite 179 und 180:
Leonrod, Ludwig Freiherr von *17.9.
- Seite 181 und 182:
Mitglieder militärisch ausbilden l
- Seite 183 und 184:
Loeb, James, Prof. Dr.h.c. *6.8.186
- Seite 185 und 186:
Zu IV. Stiftertafel im Marie-Antoni
- Seite 187 und 188:
Ein schwerer Schicksalsschlag war f
- Seite 189 und 190:
Salmen, Brigitte (2000): James Loeb
- Seite 191 und 192:
Gedenkstätte Neuhofener Schuttberg
- Seite 193 und 194:
wurde. Weitere Ablageplätze gab es
- Seite 195 und 196:
KURZBESCHREIBUNG Auf dem Gipfel des
- Seite 197 und 198:
KURZBESCHREIBUNG Diese Grabanlage (
- Seite 199 und 200:
Zu I. Kruzifix ANLASS UND ENTSTEHUN
- Seite 201 und 202:
I. Heinrich-Mann-Allee, Herzogpark
- Seite 203 und 204:
eines Menschen, bei dem Geist und T
- Seite 205 und 206:
Zuerst fand er für ein Jahr als Sc
- Seite 207 und 208:
Mann, Heinrich (1931): Fünf Reden
- Seite 209 und 210:
I. Thomas-Mann-Allee, Herzogpark M
- Seite 211 und 212:
seiner Verwandten und zog es vor, n
- Seite 213 und 214:
Der Erste Weltkrieg führte zu Span
- Seite 215 und 216:
Vom Schweizer Exil aus versuchte Th
- Seite 217 und 218:
Ehrungen 1919 Ehrendoktorwürde der
- Seite 219 und 220:
Mann, Thomas (1980): Tagebücher 19
- Seite 221 und 222:
I. Rupert-Mayer-Straße, Obersendli
- Seite 223 und 224:
Zu II. Gruft in der Krypta des Bür
- Seite 225 und 226:
KURZBESCHREIBUNG Am Eingang zum Ber
- Seite 227 und 228:
ANLASS UND ENTSTEHUNG Auf Antrag de
- Seite 229 und 230:
seiner Äußerungen drängen ließ,
- Seite 231 und 232:
Gritschneder, Otto (Hrsg.) (1987):
- Seite 233 und 234:
I. Lise-Meitner-Weg, Neuperlach-Sü
- Seite 235 und 236:
dem Leiter des Berliner Instituts f
- Seite 237 und 238:
weiter nach Schweden, wo ihr Freund
- Seite 239 und 240:
1922 Ernennung zur außerplanmäßi
- Seite 241 und 242:
Gedenktafel, St. Georg, Bogenhausen
- Seite 243 und 244:
fenberg mit der Beförderung und Ve
- Seite 245 und 246:
derkommission 20. Juli“ 464 began
- Seite 247 und 248:
Freiherr Ludwig von Leonrod *17.9.1
- Seite 249 und 250:
Moltke, Helmuth James Graf von *11.
- Seite 251 und 252:
Inzwischen geriet das väterliche G
- Seite 253 und 254:
Dieser einzige Gedanke fordert wahr
- Seite 255 und 256:
Grabmal von Dr. Emil Muhler Foto: D
- Seite 257 und 258:
Regierung der nationalen Erhebung v
- Seite 259 und 260:
Neumeyer, Karl Prof. Dr. jur. *19.9
- Seite 261 und 262:
ANLASS UND ENTSTEHUNG Auf Antrag de
- Seite 263 und 264:
Auszeichnungen. Als zwölf Jahre sp
- Seite 265 und 266:
Neumeyer, Alfred (1944): Erinnerung
- Seite 267 und 268:
Olschewski, Wilhelm sen. *18.8.1871
- Seite 269 und 270:
GESCHICHTLICHER HINTERGRUND UND DEU
- Seite 271 und 272:
I. Freiherr-von-Pechmann-Weg, Maxvo
- Seite 273 und 274:
Demokratie von tiefem Mißtrauen, j
- Seite 275 und 276:
waltherrschaft als antichristliche
- Seite 277 und 278:
Niemöller, Wilhelm (1956): Die Eva
- Seite 279 und 280:
I. Toni-Pfülf-Straße, Fasanerie-N
- Seite 281 und 282:
1915-1927 in diesem Hause.“ INFOR
- Seite 283 und 284:
Pfülf setzte ihrem Leben am 8. Jun
- Seite 285 und 286:
Denkmal am Platz der Freiheit Foto:
- Seite 287 und 288:
INFORMATION ÜBER DEN KÜNSTLER Ged
- Seite 289 und 290:
I. Denkmal M (1965) ANLASS UND ENTS
- Seite 291 und 292:
293 Politische Opfer Gedenkstätte
- Seite 293 und 294:
Literatur Aretin, Otmar von / Carta
- Seite 295 und 296:
ung nach Polen in Erwägung gezogen
- Seite 297 und 298:
I. Gedenktafel Hofstatt Marienplatz
- Seite 299 und 300:
mit getragen hatte, distanzierte si
- Seite 301 und 302:
Probst, Hermann Christoph Armando *
- Seite 303 und 304:
VIII. Grabmal auf dem Friedhof Perl
- Seite 305 und 306:
für die Natur und brachte ihnen My
- Seite 307:
Maier, Hans (1988): Christlicher Wi