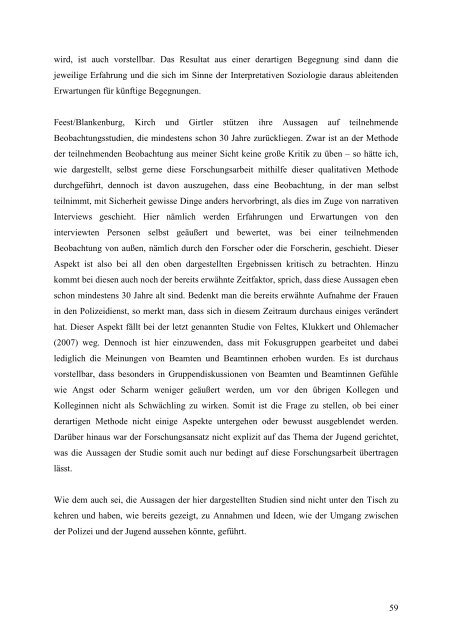- Seite 1 und 2:
Mag.(FH) Wolfgang Koller Jugend und
- Seite 3 und 4:
Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkl
- Seite 5 und 6:
4.4. Umgang der Polizei mit Jugendl
- Seite 7 und 8:
6.7.4. „Das Gesetz der Straße“
- Seite 9 und 10:
Danksagung Mein außerordentlicher
- Seite 11 und 12:
ChefInspektor Günther Ebenschweige
- Seite 13 und 14:
1. Einleitung Seit einiger Zeit bin
- Seite 15 und 16:
Meine Annahmen, die nochmals wohl a
- Seite 17 und 18:
2. Theoretische Einordnung - Interp
- Seite 19 und 20: Bedingungen erst entstehen. Es sind
- Seite 21 und 22: Abels, 2001, S. 61) und durch diese
- Seite 23 und 24: Erlebnissen mit der jeweils anderen
- Seite 25 und 26: In diesem Zusammenhang soll auch ku
- Seite 27 und 28: Benennung eines Gegenstandes bestim
- Seite 29 und 30: einzelne Mensch Status zuweisen, de
- Seite 31 und 32: 2.5.1. Abweichendes Verhalten Siegf
- Seite 33 und 34: 161, zitiert nach Lamnek, 1996, S.
- Seite 35 und 36: Polizei füreinander bereits besitz
- Seite 37 und 38: abgeschlossen. Zuvor aber, wie scho
- Seite 39 und 40: Wie bereits erwähnt, obliegt die S
- Seite 41 und 42: 34 SPG idgF.), Identitätsfeststell
- Seite 43 und 44: Handelns die kriminalpolizeiliche A
- Seite 45 und 46: körperlichen, psychischen und sozi
- Seite 47 und 48: hingewiesen, dass dieser Aspekt - a
- Seite 49 und 50: durchgeführt wird, und stellt sich
- Seite 51 und 52: Es wird sehr schnell klar, dass ein
- Seite 53 und 54: P: (.) aber sicher (.) wir hom in d
- Seite 55 und 56: I: (schmunzelt auch) Wie, wie (.) r
- Seite 57 und 58: abweichendes Verhalten definiert wu
- Seite 59 und 60: als ob dabei wiederum die Erlebniss
- Seite 61 und 62: handelt es sich bei der Polizei um
- Seite 63 und 64: psychologische und pädagogische Zu
- Seite 65 und 66: Ein letzter Aspekt, der hier heraus
- Seite 67 und 68: Zivil wahrgenommen wurde, leitete e
- Seite 69: Lehrstuhl für Kriminologie und Pol
- Seite 73 und 74: ereits kenne oder nicht. „Wenn ma
- Seite 75 und 76: Ebenfalls mit dem Thema des Bilds d
- Seite 77 und 78: Wiener Polizisten waren auch alle
- Seite 79 und 80: „(…) möglicherweise bedarf es
- Seite 81 und 82: „schwarze Schafe“ die gesamte P
- Seite 83 und 84: offiziellen Kontakten resultieren,
- Seite 85 und 86: Polizei und Jugendlichen mit Migrat
- Seite 87 und 88: Ebenfalls im Zuge der Behandlung ru
- Seite 89 und 90: Jungen oder das Mädchen nicht in e
- Seite 91 und 92: Polizei“ - so etwa, dass manche J
- Seite 93 und 94: Die von Behr soeben beschriebenen z
- Seite 95 und 96: Der Umgang miteinander scheint also
- Seite 97 und 98: auch in einer respektvollen Art und
- Seite 99 und 100: Definitionsmacht im Drogenmilieu, i
- Seite 101 und 102: eigenem Ermessen, etc.) schon ein g
- Seite 103 und 104: Institution Polizei ergeben“ (Ges
- Seite 105 und 106: 4.6. Zusammenfassung und abschließ
- Seite 107 und 108: 5. Empirische Umsetzung Wie bereits
- Seite 109 und 110: 5.1.1. Offenheit Unter der Offenhei
- Seite 111 und 112: weit ist und erst im Verlauf der Un
- Seite 113 und 114: Reinders unterscheidet dabei die de
- Seite 115 und 116: die Durchführung narrativer Interv
- Seite 117 und 118: (siehe oben) hervor - so erzählte
- Seite 119 und 120: Die interviewten Jugendlichen: Anon
- Seite 121 und 122:
Wie schon erwähnt, soll hier nochm
- Seite 123 und 124:
etwaige Inhalte oder Aussagen, die
- Seite 125 und 126:
5.8. Eigene Position Ich habe berei
- Seite 127 und 128:
Letztendlich möchte ich darauf hin
- Seite 129 und 130:
6. Ergebnisse aus der Empirie In di
- Seite 131 und 132:
interviewte Person in ihren Antwort
- Seite 133 und 134:
Und wenn es dann doch das eine oder
- Seite 135 und 136:
offenbar wenig zu geben, was sowohl
- Seite 137 und 138:
jedoch in der Sichtweise der Jugend
- Seite 139 und 140:
I: (schmunzelt auch) Jo (..) Ah (wi
- Seite 141 und 142:
Das, was sich in diesem Zitat auch
- Seite 143 und 144:
6.1.5. Die Jugend als Opfer ihrer K
- Seite 145 und 146:
Aspekt des Fußballplatzes wird im
- Seite 147 und 148:
P: Jo ah, wemma do e mit da (.) do
- Seite 149 und 150:
6.2.1. Die „braven Versager“ Mi
- Seite 151 und 152:
(Zitat aus Interview P02, Z762 - 79
- Seite 153 und 154:
Sicht dann auch noch der Aspekt, da
- Seite 155 und 156:
kommuniziert, was in der Stadt eben
- Seite 157 und 158:
In der soeben dargestellten Reihenf
- Seite 159 und 160:
Eine andere Jugendliche, die im Geg
- Seite 161 und 162:
I: Mhm P: (.) ah (.) sondern a Poli
- Seite 163 und 164:
I: (schmunzelt) (..) Ahm (.) I moch
- Seite 165 und 166:
zruckbringen miassn (.) beziehungsw
- Seite 167 und 168:
dann auch, dass die Probleme, mit d
- Seite 169 und 170:
P: A Steher is ana der (.) der BLEI
- Seite 171 und 172:
6.4.4. „Die Spur wieder verloren
- Seite 173 und 174:
öffentlichen Plätzen von, beispie
- Seite 175 und 176:
6.5. Kategorie „Vertrauen“ 6.5.
- Seite 177 und 178:
6.5.2. Vertrauen in die Person Ein
- Seite 179 und 180:
I: Hmm (schmunzelt auch, dann wiede
- Seite 181 und 182:
derartige Bemerkungen, wie soeben z
- Seite 183 und 184:
(.) auf da STRAßE gibt´s a eigene
- Seite 185 und 186:
stärker bewusst sein dürften, als
- Seite 187 und 188:
Bursch und a Mädl daher und die zw
- Seite 189 und 190:
Kategorie der Wertschätzung und de
- Seite 191 und 192:
polizeilichen Autorität, was folgl
- Seite 193 und 194:
6.6.4.1. „Davonlaufen“ von abg
- Seite 195 und 196:
Hintergrund als Motiv zu stehen sch
- Seite 197 und 198:
I: Mhm P: dann (.) kaunnst oder hos
- Seite 199 und 200:
P: WOS i sogn kaunn, ma kaunn von d
- Seite 201 und 202:
für das Verständnis der nachfolge
- Seite 203 und 204:
6.6.8. Einvernahmen Aufgrund der Ve
- Seite 205 und 206:
sehr wohl immer objektive Kriterien
- Seite 207 und 208:
der „Ohnmacht“ hineinspielt und
- Seite 209 und 210:
gesagt, hauptsächlich älteren Bea
- Seite 211 und 212:
6.7.2. Zuhören im Drogenbereich Ex
- Seite 213 und 214:
MÜSSTE ich reagiern und i denk net
- Seite 215 und 216:
I: Mhm (.) Und waunn würdst as auf
- Seite 217 und 218:
Beendigung des Interviews herausste
- Seite 219 und 220:
Der zweite Grund hat mit dem eben G
- Seite 221 und 222:
Schädldeckn einhaun, mit Oschnbech
- Seite 223 und 224:
eine gewisse Wertschätzung für ih
- Seite 225 und 226:
I: (..) Ah, wei´st gsogt host, sov
- Seite 227 und 228:
Jugendlichen zu verstehen sind. Und
- Seite 229 und 230:
Augen der Jugendlichen also kein Ga
- Seite 231 und 232:
P: (.) Jetzt im Kriminaldienst is d
- Seite 233 und 234:
6.8.1.4. „Do bin i der Chef“ Ei
- Seite 235 und 236:
I: (schmunzelt) P: Is die Stärke a
- Seite 237 und 238:
I: Wie, wie lauft do do (.) da Umga
- Seite 239 und 240:
Aspekt, nämlich mit ausländischen
- Seite 241 und 242:
6.8.1.6. „Nüchtern ein anderer M
- Seite 243 und 244:
Respekt gegenüber der Polizei am L
- Seite 245 und 246:
P: und die aundan, die (.) an Nocht
- Seite 247 und 248:
gesetzlichen Gegebenheiten, dennoch
- Seite 249 und 250:
„Du“ ansprechen zu dürfen, so
- Seite 251 und 252:
I: Jo P: miljöbedingte Aussagn, ok
- Seite 253 und 254:
Die Jugendlichen, wie schon gesagt,
- Seite 255 und 256:
I: Mhm (..) Wie suid´s sein aus de
- Seite 257 und 258:
Beispiel von vielen zu bringen, ist
- Seite 259 und 260:
nicht erfüllt, was sodann zu Ärge
- Seite 261 und 262:
Polizeipräsenz keine Scheu mehr da
- Seite 263 und 264:
I: (ganz leise) Do gher i söwa a d
- Seite 265 und 266:
Aspekte zählen, wie beispielsweise
- Seite 267 und 268:
J: Wal wenn i´s jetzt no beschimpf
- Seite 269 und 270:
dann „eh von selbst wieda zruckku
- Seite 271 und 272:
6.9.1.9. „Stehn und zuhörn“ Eb
- Seite 273 und 274:
Das eben genannte Ohnmachtsgefühl
- Seite 275 und 276:
Interview J10, Z506 - 507). Sodann,
- Seite 277 und 278:
J: Sama ins UUU (öffentliche Einri
- Seite 279 und 280:
I: Mhm (..) Wos host da gedocht? J:
- Seite 281 und 282:
J: Die Polizistn (.) ah (.) jo, (.)
- Seite 283 und 284:
nachstehenden Zitat aus dem Intervi
- Seite 285 und 286:
nach solchen Kriterien oder Merkmal
- Seite 287 und 288:
könne man nicht um die Hilfe der P
- Seite 289 und 290:
Stecken“ haben. Auch als positiv
- Seite 291 und 292:
Augen der Jugendlichen, die ein Gle
- Seite 293 und 294:
heraus muss man also mit immenser V
- Seite 295 und 296:
dann, wenn sie unschuldig verdächt
- Seite 297 und 298:
hier aber eher im Sinne einer Aufkl
- Seite 299 und 300:
wie diese Studie, zum Ziel gesetzt
- Seite 301 und 302:
herumtanzen“ würden, wie sie es
- Seite 303 und 304:
Auf der Seite der Jugendlichen gibt
- Seite 305 und 306:
Literaturverzeichnis Abels, Heinz (
- Seite 307 und 308:
Feltes, Thomas (1995): Alltagshande
- Seite 309 und 310:
Lamnek, Siegfried (1996): Theorien
- Seite 311 und 312:
Strauss, Anselm / Corbin, Juliet (1
- Seite 313 und 314:
Anhang Anonymitätsgarantie zum Int
- Seite 315 und 316:
Interviewleitfaden „Jugend“ Ver
- Seite 317:
sogn söwa, sölwa Strof, Strofn su