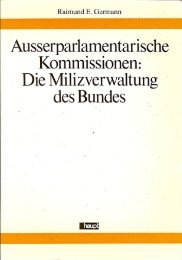Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
123<br />
sollen. Im Durchschnitt waren indessen die französischen Regierungen der Vierten<br />
noch kurzlebiger als jene der Dritten Republik. Der Übergang zur Fünften<br />
Republik erfolgte in einem Klima der Gewalt.<br />
In der Zeit von 1945–1950 legten sich gegen 50 Staaten neue Verfassungen zu. 6<br />
Sowohl die Zweite Welt der sozialistischen Länder wie die Dritte der sogenannten<br />
Entwicklungsländer fand es gleichermassen notwendig, sich mit Verfassungsdokumenten<br />
auszustatten. Karl Loewenstein bezeichnete diese Inflation von geschriebenen<br />
Verfassungen schlicht als „Verfassungsepidemie“ <strong>und</strong> führte in seiner „Verfassungsontologie“<br />
die Unterscheidung zwischen „normativen“, „nominalistischen“<br />
<strong>und</strong> „semantischen“ Verfassungen ein. Darnach sind als normativ jene Verfassungen<br />
anzusehen, die mit der politischen Wirklichkeit übereinstimmen <strong>und</strong> wirklich<br />
befolgte Spielregeln für den politischen Prozess liefern. Eher ein politisches Programm,<br />
das sich in der Zukunft verwirklichen soll, ist die nominalistische Verfassung;<br />
sie wartet gutgläubig darauf, dass sich die politischen Verhältnisse einmal<br />
ihren Anordnungen fügen werden. Die semantische Verfassung kommt zwar vollständig<br />
zur Anwendung, ist aber nichts anderes als die fortwährende Bestätigung<br />
des augenblicklichen Machtzustandes. Sie bildet nicht den objektiven Rahmen für<br />
das Kräftespiel <strong>und</strong> den Machtausgleich im politischen System; sie ist Fassade,<br />
hinter der sich der politische Prozess nach eigenen Gesetzen abspielt. 7 – Das Hervortreten<br />
der symbolischen oder rituellen Bedeutung zahlreicher Verfassungen aus<br />
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg brachte die Idee zum Verblassen, das Gemeinwesen<br />
durch Verfassungsrecht gr<strong>und</strong>legend gestalten zu wollen.<br />
Neue Erkenntnisse der Politikwissenschaft reduzierten das Interesse an formalen<br />
Verfassungseinrichtungen. 1951 verkündete Maurice Duverger, dass für die Kenntnis<br />
eines politischen Systems das Studium des Parteiengefüges wichtiger sei als<br />
Verfassungsanalyse: „Qui connaît le droit constitutionnel classique et ignore le rôle<br />
des partis, a une vue fausse des régimes politiques contemporains; qui connaît le<br />
rôle des partis et ignore le droit constitutionnel classique, a une vue incomplète<br />
mais exacte des régimes politiques contemporains.“ 8 Harry Eckstein fasste 1963<br />
die neue Optik wie folgt zusammen:<br />
„Nowadays, however, much more is attributed to the social forces than in the<br />
past. Wie simply know too much now about the ways in which constitutional<br />
contrivances can be vitiated. They may be modified by usage, coming to embody<br />
more and more the very political habits they are supposed to shape. They<br />
may simply be ignored in practice – as the power of the executive to dissolve<br />
parliament atrophied from disuse in the Third Republic. Behavior may simply not<br />
fully conform to them. We also know a good deal now about the obscure and<br />
complicated forces that govern the distribution of power and the competition for<br />
offices and policy in any society; about the role and influence of informal political<br />
processes, like those of pressure groups; and about the importance of ‚political<br />
culture’,<br />
6 Eckstein, op. cit., S. 102.<br />
7 Karl Loewensteln, Verfassungslehre, Tübingen 1959, S. 151 ff.; derselbe, „Verfassungsrecht <strong>und</strong> Verfassungsrealität“,<br />
in: derselbe, Beiträge zur Staatssoziologie, S. 447; derselbe, „Reflections on the Value<br />
of Constitutions in our Revolutionary Age“, in: Eckstein/Apter, op. cit., S. 154.<br />
8 Maurice Duverger, Les partis politiques, Paris 1951 (7. Auflage 1969), S. 388.