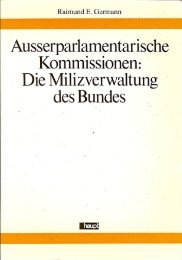Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
161<br />
1874. 5a Das Urteil über die retardierende Wirkung des Gesetzesreferendums gründete<br />
ursprünglich auf der Beobachtung, dass die konservativ-föderalistische Rechte<br />
im ausgehenden 19. Jahrh<strong>und</strong>ert diese Institution mit grosser Effizienz als Oppositionsinstrument<br />
zu verwenden wusste. Sie brachte mehrere Gesetzesvorlagen der<br />
Regierungsmehrheit in die Volksabstimmung, welche häufig negative Resultate<br />
zeitigte. – Unterdessen hat das fakultative Referendum seine demokratische Funktion<br />
eingebüsst <strong>und</strong> führt, bezogen auf die Gesamtzahl der verabschiedeten Gesetze,<br />
nur noch selten <strong>und</strong> in marginalen Angelegenheiten zu Volksabstimmungen.<br />
Seine konservative Funktion hat es indessen bewahrt. Dies lässt sich durch folgende<br />
Theorie veranschaulichen. Im Bargaining-Prozess der Interessengruppen gewährt<br />
die Referendumsinstitution unterschiedliche „Drohpotentiale“; Referendumsdrohungen<br />
sind gr<strong>und</strong>sätzlich nicht gleichwertig, sie haben je nach den Ressourcen<br />
des Drohenden <strong>und</strong> dessen Zielsetzung unterschiedliche Glaubwürdigkeit. – Vorerst<br />
hängt die Glaubwürdigkeit der Drohung von den organisatorischen <strong>und</strong> finanziellen<br />
Mitteln des Drohenden ab. Nur wer glaubhaft macht, dass er imstande ist,<br />
die erforderlichen 30 000 Unterschriften innert Frist zu sammeln <strong>und</strong> im Wahlkampf<br />
für seinen Standpunkt eine genügende Propaganda zu bezahlen, ist „referendumsfähig“<br />
<strong>und</strong> kann mit der Volksabstimmung glaubwürdig drohen. (Vorparlamentarische<br />
BargainingProzesse haben ohnehin die Tendenz, nur „referendumsfähige“<br />
Gruppen einzubeziehen.) – „Referendumsfähigkeit“ ist selbstverständlich stets in<br />
unterschiedlichem Ausmass vorhanden; je organisationsstärker <strong>und</strong> finanzkräftiger<br />
ein Verband ist, desto glaubwürdiger seine Referendumsdrohung. Dieses plutokratische<br />
Kriterium dürfte sich, so vermuten wir, zugunsten des Status quo auswirken;<br />
denn Saturierte suchen nicht die Veränderung. – Nicht nur die Höhe der Ressourcen<br />
des Drohenden beeinflussen die Glaubwürdigkeit seiner Drohung, sondern<br />
auch die Distanz, die zwischen seiner Zielsetzung <strong>und</strong> dem Status quo liegt. Ist<br />
diese Distanz Null, bevorzugt also ein Verhandlungspartner möglichst die Beibehaltung<br />
des Status quo, so birgt eine Volksabstimmung nur ein geringes Risiko für ihn;<br />
er kann (von den Kosten des Abstimmungskampfes abgesehen) praktisch nur gewinnen.<br />
Wird die Vorlage vom Volk verworfen, so ist sein Ziel optimal erfüllt; denn<br />
der Status quo bleibt erhalten. Wird sie dagegen angenommen, so wird der Kompromiss<br />
verwirklicht, den der Gegenspieler angeboten hatte, die Niederlage ist also<br />
nicht total. Wenn das Volk gegen den Status-quo-Spieler entscheidet, so erhält<br />
dieser immer noch, was er auch ohne Abstimmung erhalten hätte. – Beim <strong>Innovation</strong>s-Spieler<br />
dagegen, dessen Zielsetzung erheblich entfernt ist vom Status quo,<br />
liegt das Risiko bedeutend ungünstiger; er kann praktisch nur verlieren. Nimmt das<br />
Volk die Vorlage an, so wird nur der Kompromissvorschlag des Gegenspielers<br />
verwirklicht; das <strong>Innovation</strong>sziel ist also nicht optimal erfüllt. Bei negativem Volksentscheid<br />
ist die Niederlage des <strong>Innovation</strong>s-Spielers total, - es geschieht vorerst<br />
überhaupt nichts in der Sache, der „Scherbenhaufen“ zwingt dazu, mit dem <strong>Innovation</strong>sprozess<br />
wieder von vorn zu beginnen. – Weil der Status-quo-Spieler ein bedeutend<br />
geringeres Risiko bei einer Volksabstimmung eingeht als sein Gegenspieler,<br />
ist seine Referendumsdrohung glaubwürdiger <strong>und</strong> effizienter. Dieses Ungleichgewicht<br />
spiegelt sich im politischen Jargon wieder. Eine Vorlage kann nur<br />
5a Neidhart. Plebiszit (op. cit.), S. 10 Note 5