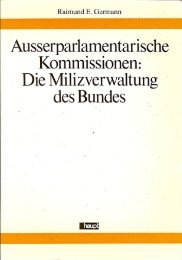Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Politische Innovation und Verfassungsreform - Badac
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
151<br />
in der Regel nur, im Zeitpunkt der Abstimmung jeweils längst überfällige Kompetenzerweiterungen<br />
für den B<strong>und</strong> oder die Beseitigung von Anachronismen (exklusives<br />
Männerstimmrecht, Ausnahmeartikel) zu akklamieren. – Was die Verfassungsinitiative<br />
betrifft, so ist sie mit der lähmenden Gewissheit verknüpft, dass<br />
Initiativbegehren vom Volk regelmässig verworfen werden. Im Falle der Überfremdungsinitiativen<br />
kann der Bürger nach Darstellung der „politischen Klasse“ ohnehin<br />
nur wählen zwischen Prosperität <strong>und</strong> Chaos. 17<br />
Die vorgelegte Analyse der direktdemokratischen Partizipationsrechte auf B<strong>und</strong>esebene<br />
gehen von einer bestimmten Werthaltung aus, die explizit zu machen ist.<br />
Diese verlangt, dass dem Bürger sinnvolle formelle Partizipationsrechte einzuräumen<br />
sind, die gr<strong>und</strong>sätzlich geeignet sind, das politische Geschehen signifikant zu<br />
beeinflussen. Diese Werthaltung ist nicht selbstverständlich. Das „revisionistische“<br />
Demokratieverständnis geht von der empirischen Feststellung aus, dass eine breite<br />
Mehrheit der Bürger über Politik schlecht informiert <strong>und</strong> wenig daran interessiert<br />
ist. 18 Ob formelle Partizipationsrechte nun objektiv geeignete Instrumente sind, auf<br />
das politische Geschehen einzuwirken, erscheint in diesem Lichte als unwichtig.<br />
Von der Mehrheit der Bürger darf ja angenommen werden, dass es ihnen gleichgültig<br />
ist, wie die Volksrechte ausgestaltet sind, ob sie nun mehr oder weniger taugliche<br />
Partizipationschancen einräumen. 19 Das Interesse des Forschers kann sich<br />
daher auf den äusseren, beobachtbaren Partizipationsakt unabhängig von dessen<br />
Sinnhaftigkeit beschränken. Unterschiede in der Stimm- <strong>und</strong> Wahlbeteiligung <strong>und</strong><br />
im Stimm<strong>und</strong> Wahlverhalten werden in Beziehung gesetzt zu Alter, Geschlecht,<br />
Beruf, Einkommen, Konfession, Parteizugehörigkeit <strong>und</strong> ähnlichen Merkmalen des<br />
Stimmbürgers. – Als zentraler Wert, auf den revisionistische Demokratietheorie<br />
häufig ausgerichtet ist, erscheint das „Überleben des politischen Systems“, die<br />
politische Stabilität. Die weitverbreitete politische Apathie der Bürger erhält eine<br />
positive Einschätzung, weil sie als wichtige Voraussetzung für Systemstabilität<br />
erachtet wird. Bernhard Berelson führte aus:<br />
„How could a mass democracy work if all the people were deeply involved in<br />
politics Lack of interest by some people is not without its benfits, too. True, the<br />
highly interested voters vote more, and know more; however, they are also less<br />
open to persuasion and less likely to change. Extreme interest goes with extreme<br />
partisanship and might culminate in rigid fanaticism that could destroy<br />
democratic processes if generalized throughout the community. Low affect toward<br />
the election – not caring much <strong>und</strong>erlies the resolution of many political<br />
problems . . .“ 20<br />
Und Jürg Steiner fand im Falle der Schweiz folgende Hypothese bestätigt, beziehungsweise<br />
nicht widerlegt:<br />
17 Siehe oben S. 117, Note 17; ebenfalls: Jürg Tobler, Testfall 7. Juni 1970, Zürich 1971.<br />
18 Zur revisionistischen Demokratietheorie siehe die Beiträge von Schumpeter, Michels, Dahl, Lindblom,<br />
Almond, Verba, J.Q. Wilson, Berelson, Buchanan, Tultoch, Milbrath <strong>und</strong> Lasswell in: Kariel, op. cit., S.<br />
35–94. Ebenfalls: Scharpf, op. cit., S. 28. Siehe auch oben S. 118.<br />
19 In dieser Richtung: Kirkpatrick, Two-Party System (op. cit.), S. 971 ff.<br />
20 Bernard R. Berelson/Paul F. Lazarsfeld/William N. McPhee, Voting. A Study of Opinion Formation in a<br />
Presidential Campaign, The University of Chicago Press, Chicago 1954 (5. Auflage 1966), S. 314.